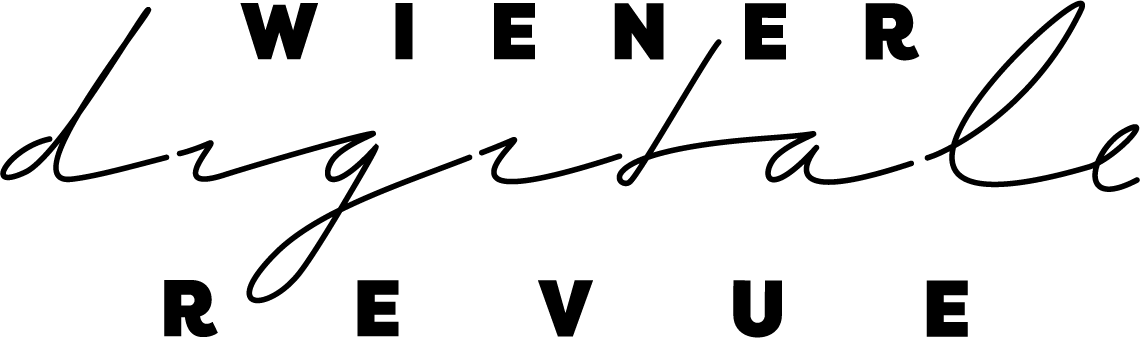
Zeitschrift für Germanistik und Gegenwart
Anne D. Peiter
Der Alltag des Tötens
Der Tutsizid in Ruanda als „landwirtschaftlicher Genozid“ im Spiegel von Jean Hatzfelds Täter-InterviewsLizenz:
For this
publication, a Creative Commons Attribution 4.0 International license
has been granted by the author(s), who retain full
copyright.
Link
Wiener Digitale Revue 5 (2024)
www.univie.ac.at/wdrAbstract
Top of pageInhalt
Top of pageVolltext
Top of pageOn avait plus peur de la colère des
(Pancrace Hakizamungili in Hatzfeld 2003: 80)
autorités que du sang qu’on faisait couler. 1
Ausgehend von der Interview-Sammlung Une saison de machettes (‚Eine Jahreszeit der Macheten‘) des französischen Journalisten und Enkel von Shoah-Überlebenden Jean Hatzfeld möchte ich den ‚criminal minds‘ einer Tätergruppe nachforschen, die nach dem Abschuss des Flugzeugs des ruandischen Präsidenten, d.h. ab dem 6. April 1994, aktiv am Genozid gegen die Tutsi Ruandas beteiligt waren und danach zum Teil lange Gefängnisstrafen zu verbüßen hatten bzw. gar zum Tode verurteilt wurden. Die Interviews sind historisch von großer Bedeutung, da Hatzfeld sehr früh Richtung Ruanda aufbrach. Er gehörte zu den ersten Europäern, die sich mit der Katastrophe, die innerhalb von nur drei Monaten mehr als einer Million Menschen das Leben gekostet hatte, beschäftigten.
Hatzfeld stellt in der genannten wie auch in anderen Publikationen die Kontinuitätslinien heraus, die sich zwischen der bis dahin üblichen Feldarbeit und ihren Werkzeugen auf der einen und der genozidalen Tötungspraxis auf der anderen Seite ergaben. Es wird ein Genozid postuliert, der zumindest zum Teil als „agrarischer Genozid“2 (Hatzfeld 2003: 79) beschrieben werden könne. Es steht nicht in Frage, dass durch die Präsidenten-Garde, Polizei, Gendarmen und nicht zuletzt die Miliz der Interahamwe auch mit Granaten, Schusswaffen und anderem schweren Gerät getötet wurde. Diesen ‚Aktionen‘ fiel in kürzesten Zeiträumen eine große Zahl von Menschen zum Opfer. Doch es ist zugleich zu beobachten, dass die von Hatzfeld Interviewten Wert auf die Feststellung legten, sie seien ihren einstigen ‚Arbeitsrhythmen‘ gefolgt und hätten, als sie Mensch töteten, die gleiche Leichtigkeit im Umgang mit ihren Werkzeugen erfahren wie früher bei ihrer Rodungs- und Feldarbeit. Aus den Interviews spricht eine Art von autotelischer Redundanz,3 die auf das Argument hinausläuft, die Amputationen, die vor allen Dingen mit Hilfe von Macheten erfolgten (und übrigens sowohl die Rinder der Tutsi als auch ihre Besitzer betrafen),4) seien eine ‚Selbstverständlichkeit‘ gewesen, weil man auf diese Weise immer schon Bananenhaine beschnitten oder andere Feldarbeiten ausgeführt habe.
Dass sich die Massaker vielfach in Räumen abspielten, die den Täter:innen von ihrem Alltag her vertraut waren, erklärt ebenfalls, warum sie von ihren Plünderungen erzählen, als habe es sich um normale ‚Ernten‘ gehandelt. Genutzt wurden dabei identitäre Abgrenzungsmechanismen, die die späteren Opfer dehumanisieren und sie zu ‚Kakerlaken‘ oder ‚Schlangen‘ machen sollten. Der Einsatz der Macheten kann auch auf dieses instrumentelle Dispositiv des Staates zurückgeführt werden. Er gehörte zu den Strategien der Ideologen des ‚Hutu-Power‘, die Zivilbevölkerung auf systematische Weise in den Genozid zu involvieren, um auf diese Weise die ‚criminal minds‘ zu einer allgemeinen, die gesamte Gesellschaft umfassenden Haltung zu machen. Es ist kein Zufall, dass schon im Vorfeld des Genozids Macheten in großen Mengen aus China importiert wurden. Diese waren vergleichsweise billig, konnten also an einen weiten ‚Empfängerkreis‘ verteilt werden.
In meinem Beitrag möchte ich nun versuchen, diese ‚Veralltäglichung‘ bzw. ‚Verselbstverständlichung‘ (vgl. Peiter 2007a) einer Gewalt zu beschreiben, die durch die lange koloniale Vorgeschichte vorgeprägt war, 1994 aber zu einem paroxystischen Höhepunkt fand. Es soll bedacht werden, wie Gewöhnungsprozesse, die in den Dörfern schon während der großen Krisen und Pogrome der Jahre 1959 (der so genannten ‚sozialen‘ oder ‚Hutu-Revolution‘), 1962, 1973 und nicht zuletzt der Jahre seit Kriegsbeginn (1990-1994) eingesetzt hatten, fortwirkten. Anhand von autobiographischem Material einzelner Täter soll systematisierend beschrieben werden, mit welchen Worten die Mörder auf ihr bäuerliches Leben, seine Kontinuitäten und seine Genozid-bedingten Brüche blickten.5 In den mikroökonomischen Strukturen der ruandischen Gesellschaft war es üblich, dass sich auch auch Beamt:innen, Polizisten oder Lehrer:innen der Landwirtschaft als Nebenaktivität widmeten. Bei Hatzfeld wird denn auch in der Tat ein breites soziales Spektrum aufgefächert. Dies zeigt, dass der Begriff des ‚Bäuerlichen‘ bzw. ‚Agrarischen‘ im Folgenden sehr weit gefasst verstanden werden muss.
Offensichtlich ist, dass die Aussicht, zu plündern und an die Stelle der Feldarbeit die Bereicherung an dem mobilen und vor allen Dingen immobilen Besitz der Tutsi – der Besitz von Ackerland spielte hier eine entscheidende Rolle6 – zu setzen, als ein Motiv fungierte, das die Beteiligung an den Massakern in ökonomischer Hinsicht attraktiv machte. Darüber hinaus konnten jedoch Arbeitszeiten und Werkzeuggebrauch fortgesetzt werden, wie sie schon in der Zeit vor dem Genozid praktiziert wurden. Eine Mischung aus Unalltäglichem und Gewohntem, Festtäglichem und Normalität zeigte sich auch in den Feiern, die des Abends in vielen Dörfern nach getaner ‚Arbeit‘ (so der verbreitete Euphemismus fürs Töten) die Bewohner:innen zusammenführten. Waren Musikkassetten und Batterien für die Rekorder erbeutet worden, gab es auch eine musikalische Untermalung – von großen Gelagen und Besäufnissen einmal ganz zu schweigen.7
Indem ich den Zeugnissen in einer Art Mikrostudie, die ich methodisch als ‚Lektüre der Unverhältnismäßigkeit‘ (vgl. Peiter 2019) bzw. ‚Radikalisierung von Genauigkeit‘ bezeichne, auf den Grund zu gehen versuche, soll zugleich herausgearbeitet werden, dass die ideologische Vorbereitung des Genozids, wie sie mit Hilfe der so genannten ‚hamitischen Theorien‘8 schon Jahrzehnte zuvor durch die deutsche und belgische Kolonialisierung des Landes erfolgt war, nur in einer deutsch-ruandischen Verflechtungsgeschichte begriffen werden kann.9 Dass sich die Gewalt oft gegen die Statur der Tutsi – ihre vermeintlich ‚rassisch‘ erklärbare Größe und ihre sich in dieser Größe sich aussprechende ‚Arroganz‘ – richtete, kann nur vor dem Hintergrund eines Klassifizierungs- und Ordnungswahns verstanden werden, der im Kolonialismus schrittweise zur künstlichen ‚Ethnifizierung‘ der ruandischen Gesellschaft geführ hatte.
Der Einfluss des Kolonialismus bestand jedoch nicht allein in der Ethnizifizierung. Vielmehr trat eine politische Manipulation der so konstruierten Gruppen hinzu. Nicht zuletzt die belgische Kolonialpolitik hatte zu einer Frontstellung zwischen gegnerischen Gruppen geführt. Die Tutsi, denen bis 1959 alle sozialen Privilegien zuerkannt worden waren, wurden entmachtet, so dass sich die Hutu, also die ehemaligen Benachteiligten, in einem plötzlichen Wechsel in der dominanten Position befanden. Die koloniale Divide-et-impera-Strategie legte den Grundstein für die tödlichen Rivalitäten der nachkolonialen Zeit. Diese geben wiederum den Hintergrund für die politischen Verfolgung der sogennanten „Tutsi“ ab.
Zum Abschluss wird der Frage nachzugehen sein, inwieweit Hatzfelds Buch zwischen historiographischem Dokument und Literatur changiert. Da die Interviews nicht in voller Länge abgedruckt sind, sondern thematisch geordnet in kleinen Bruchstücken einem kunstvollen Prinzip der Montage folgen, zeichnet sich die These ab, hier würden die ‚criminal minds‘ nicht mehr allein den jeweiligen Individuen zugeordnet. Vielmehr entsteht zusätzlich so etwas wie eine ‚Kollektivbiographie‘.10 Durch sie tritt dann auch die Gemeinsamkeit des kriminellen Tuns, die Interaktion der Täter:innen, der allen gemeinsame Habitus sowie schließlich ihre historisch bedingte Erwartung hervor, zu einer Bestrafung könne es unmöglich kommen. Pate stand der Gedanke, es seien diejenigen, die in den Jahrzehnten zuvor Massaker begangen hatten, noch nie zur Verantwortung gezogen worden. Die Straflosigkeit, die die jahrzehntelange Geschichte der Gewalteskalation geprägt hatte, verstärkte die Normalisierung des Tötens. Doch selbstverständlich erklärt diese nicht allein, dass es 1994 zu einem Genozid kam. Es mussten viele weitere Faktoren hinzutreten. Zu ihnen gehörte die Initiative des Staates, der die Verbrechen nicht nur guthieß, sondern auch den organisatorischen Rahmen abgab. Außerdem verschärfte sich die Machtkonkurrenz im Kontext des Bürgerkriegs. Dies nutzten wiederum die extremistischen Hutu-Gruppen als ‚Argument‘, um die Vernichtung der Tutsi und andersdenkender Hutu zu ‚legitimieren‘.
Wie das oben erwähnte ‚Unverhältnismäßige‘ mit dem Interesse für die ‚kollektiv-biographischen‘ Zeugnisse in Verbindung treten kann, wird in den folgenden Analysen ausgeleuchtet. Hier sei vorab nur angemerkt, dass im juristischen Bereich stets eine Kritik impliziert ist, wenn man sagt, das Urteil eines:r Richter:in sei ‚unverhältnismäßig‘. Die Bestrafung muss, rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechend, in einem ausgewogenen Verhältnis zu der Tat stehen, die es zu beurteilen gilt. Wenn nun aber gerade das Unverhältnismäßige zur Maßgabe einer philologischen Annäherung an Texte erhoben wird, dann soll damit gezeigt werden, dass es, ähnlich wie in der Shoah, um einen ‚Zivilisationsbruch‘ geht (vgl. Diner 1988), der die Frage nach dem ‚Maßhalten‘ des Lesens radikal in Frage stellt.
Die Lektüre auf kleine und kleinste Details zu konzentrieren und denselben eine gleichsam ‚übermäßige‘ Bedeutung beizumessen, ist die Reaktion auf die schiere Unfasslichkeit der Verbrechen, die im Tutsizid begangen wurden. Indem ich nicht nur genau hinschaue, sondern in immer neuen Kreisen die immer selben Aussagen in Augenschein zu nehmen versuche, soll eine Radikalisierung des bekannten ‚close readings‘ hin zu einem ‚closest reading‘ bewerkstelligt werden.
Auf diese Weise werde es möglich, so die These, die Gemeinsamkeiten zu fassen, die zwischen den von Hatzfeld interviewten Tätern11 kriminelle Bande noch über den Moment hinaus entstehen ließen, in dem sie ihre Nachbar:innen getötet hatten. Im Zentrum stehen also Einzelaussagen, und diese Einzelaussagen sollen durch genaue Blicke auf Worte und Wendungen in ihrer Unabhängigkeit wahrgenommen werden. In einem zweiten Schritt ist es jedoch unabdingbar, dann auch die erwähnten ‚kollektivbiographischen‘ Züge zu beschreiben.
Hier lehne ich mich methodisch an das wachsende Interesse der Forschung an den so genannten ‚Autosoziobiographien‘ an (vgl. Lammers/Twellmann 2021), die wesentlich von Pierre Bourdieu beeinflusst wurden.12 Das, was zum Beispiel die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte versucht hat, schreibend umzusetzen, darf als paradigmatisch für diese distanzierte Sicht auf das eigene Ich gelten. In ‚Autosoziobiographien‘ geht es nicht nur um die Entwicklung des:der Einzelnen, sondern auch und mehr noch um den sozio-ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungsrahmen, in den sich diese:r Einzelne von Geburt an gestellt sieht. Die literarische Arbeit gilt Mechanismen der sozialen Reproduktion ebenso wie der unbewussten Übernahme eines Habitus, der nur scheinbar auf individuellen Entscheidungen beruht, in Wirklichkeit aber die Wirkungsmacht von sozialen Codes und Erwartungen beweist, die dem:der Einzelnen in gewisser Weise seine:ihre Einzigartigkeit nehmen.
Für meinen Kontext ist dieser kulturgeschichtliche und soziologische Zugriff insofern wichtig, als ja das Einzelverbrechen in Genoziden nicht primär im Vordergrund stehen kann. Die Frage, die vorrangig Aufklärung verdient, gilt dem Problem, wie Kollektive zu riesigen Mordapparaten werden können, wie Täter:innen sich in ihrem Tun gegenseitig stützen und bestärken – und nicht so sehr, ob der:die Einzelne sozusagen ‚unabhängig‘ von dieser Normalisierung von Massengewalt, quasi ‚an und für sich‘, ‚aus eigenem Antrieb‘, kriminelle Energien aufwies.
Dans une démarche à la fois structuraliste et constructiviste, Pierre Bourdieu appréhende les comportements humains comme la conséquence d’une structure intériorisée qui se traduit par une action non réfléchie des participants mais qui conforte, inconsciemment, les positions de chacun dans l’espace social. (Coudray 2019) Pierre Bourdieu sieht, indem er auf strukturalistische und konstruktivistische Weise vorgeht, die menschlichen Verhaltensweisen als Folge einer interiorisierten Struktur, die in einer unreflektierten Handlung der Teilnehmenden zum Ausdruck komme und zugleich unbewusst die Positionen eines jeden im sozialen Raum verstärke. [Übersetzung A.P.]
Besonders an Hatzfelds Täter-Buch ist vor dem Hintergrund dieser methodischen Überlegungen, dass er die Aussagen nicht als fortlaufenden Text präsentiert, sondern sie thematisch großen Blöcken – zum Beispiel dem ‚ersten Mal‘, d.h. dem ersten Mord – zuordnet. Gerade dadurch, dass die Stimmen verschiedener Täter unmittelbar aufeinander folgen, wird es aber möglich, Vergleiche zwischen ihnen zu ziehen und sie über die Grenzen des Individuellen hinweg als Bestandteil eines größeren Ganzen zu sehen. Das Literarische an dieser Montage besteht darin, dass Hatzfeld kondensierend wirkt, nur das aufnimmt, was ihm für eine bestimmte Frage einschlägig zu sein scheint. Das heißt: Es erfolgt im Sinne Bourdieus eine Einladung an die Leserschaft, den Einzelnen stets als Mitglied einer Gruppe zu sehen, die gemeinsam die Verbrechen beging.
Am Ende meiner Ausführungen steht dann aber die Frage, inwieweit sich der Begriff des ‚criminal minds‘ aufrechterhalten lässt. Treten wir hier nicht in Größenordnungen ein, die mit einem gleichsam ‚normalen‘ Verbrecherbegriff gar nicht mehr zu fassen sind?
Eine letzte, dieses Mal terminologische Bemerkung soll diese Einleitung abschließen. Es ist soeben vom ‚Tutsizid‘ die Rede gewesen. Dieser Neologismus, der, ausgehend vom Wort ‚Genozid‘ gebildet wird, kann zu Missverständnissen führen. Es könnte der Eindruck entstehen, dass ausschließlich die Tutsi zu Opfern des genozidalen Apparates geworden sind. Das ist nicht korrekt. Wie erwähnt, sind auch politische Oppositionelle aus den Reihen der Hutu sowie allgemein Menschen, die sich dem Genozid in den Weg stellten, in die Tötungen einbezogen worden. Die Zahl der ermordeten Hutu wird auf 200.000 geschätzt. In dieser Hinsicht erscheint also der Begriff des ‚Tutsizids‘ als zu eng. Auf der anderen Seite ist jedoch so häufig und stets irreführend vom ‚ruandischen Genozid‘ die Rede gewesen, dass auf ein anderes Problem aufmerksam gemacht werden muss: Die These vom ‚doppelten Genozid‘, die dem Negationismus weit über Ruanda hinaus Nahrung gibt, behauptet einen ‚Gleichstand‘ der Gewalt, macht also aus den Tutsi die eigentlichen Täter sowie Verursacher des Genozids. Vom ‚Tutsizid‘ zu sprechen, hat den Vorteil, in diesem Punkte Klarheit zu schaffen. 1994 hat es einen Genozid radikaler Hutu gegen die Tutsi gegeben. Es hat keinen Genozid der Tutsi Ruandas an den Hutu gegeben. Man möge also diesen Begriff in allen folgenden Analysen in diesem Lichte betrachten.
1. Das Töten als Arbeit
Ich möchte mich nun den oft schier unaushaltbaren Aussagen nähern, die Jean Hatzfeld im Gefängnis von Rilima zusammengetragen hat. Der Genozid des Jahres 1994 war das Ergebnis einer langen Vorgeschichte, die seit der so genannten ‚sozialen‘ oder ‚Hutu-Revolution‘ des Jahres 1959 (vgl. Prunier 1995) von immer wiederkehrenden Pogromen, Vergewaltigungen, Vertreibungen und Plünderungen begleitet wurde. Manche Hutu – offenbar meist Männer – hatten sich schon lange vor 1994 mit dem Töten vertraut gemacht oder waren gar eingerückt in die Reihen der ‚Profis‘, nämlich der Miliz, die sich ‚Interahamwe‘ nannte. Einer von ihnen – ein gewisser Elie – berichtet rückblickend, d.h. nach seiner Verurteilung:
Une année était calme, une année était chaude. Et ça recommençait, deux saisons calmes, une saison chaude. Ça dépendait des attaques des inkotanyi, mais ça pouvait bien dépendre aussi de nous. Ordinairement on respectait des listes de priorités: les possédants de parcelles intenses et les enseignants étaient inscrits en haut ... Par après, on pouvait tuer çà et là des petits comités de Tutsi selon comme [sic !] la situation se présentait. Une année par exemple, on a poussé vivants des centaines de Tutsi dans la mare de l’Urwabaynanga; une autre année, on a lancé des expéditions sanglantes dans des salles de classe. On pouvait bien laisser quelques morts sur le bord de la route sans raison valable, sauf de bien montrer ces cadavres en même temps que nos arrière-pensées. L’année 1992 a été très brûlante à cause des périls pressants des inkotanyi. (Elie Mizinge in Hatzfeld 2003: 65) Ein Jahr war ruhig, ein anderes Jahr war heiß. Und dann fing das wieder an, zwei Jahreszeiten Ruhe, eine Jahreszeit heiß. Das hing von den Angriffen der Inkotanyi ab, doch es konnte auch von uns selbst abhängen. Normalerweise respektierten wir die Prioritätenliste: Die Besitzer von ergiebigen Feldern und die Lehrer standen ganz oben ... Später konnten wir kleine Einheiten von Tutsi töten, wie sich’s durch die Situation gerade ergab. In einem Jahr haben wir zum Beispiel Hunderte von Tutsi in die Sümpfe von Urwabaynanga getrieben; in einem anderen Jahr haben wir blutige Expeditionen hinein in die Klassenzimmer der Schulen getragen. Wir konnten gut einige Tote am Rand der Straße liegen lassen, und zwar ganz ohne guten Grund, einfach, um diese Leichen und zugleich unsere Hintergedanken vorzuzeigen. Das Jahr 1992 war wegen der drohenden Gefahren durch die Inkotanyi sehr hitzig. [Übersetzung A.P.]
Insgesamt galt, dass es zu einer schrittweisen Enthumanisierung kam. Sie wurde durch mehrere Faktoren angetrieben: die diskriminatorische (und schließlich mörderische) Praxis in Schulen und Universitäten spielte eine Rolle; die Verbreitung von entsprechenden Radio-Sendungen kam hinzu.13 Die öffentliche Demonstration von Willkür bei Verhaftungen und Tötungen14 sowie die von staatlichen Autoritäten erstellten Namenslisten vermittelten den Täter:innen des eigentlichen, ‚großen‘ Genozids ein Gefühl der Sicherheit. Die verschwörungsmythischen Erzählungen, die besagten, die Tutsi seien sämtlich mit der Exilarmee der FPR – den ‚Inkotanyi‘, d.h. den ‚Unbesiegbaren‘ – verbündet,15 trugen ein Übriges dazu bei, die allgemeine Angst der Hutu in Tötungsenergie umzumünzen. Solche Ängste waren ein probates Instrumentarium der politischen Manipulation. Zu Tage trat eine Logik, die auf der Überzeugung beruhte, die Tutsi planten Massaker, denen die Hutu als anvisiertes ‚Opfer‘ mit großer Schnelligkeit zuvorkommen müssten – sozusagen als ‚präventive Maßnahme‘, d.h. als Ergebnis von Reaktionen und nicht etwa als Ergebnis eigener Aktionen.
Die These der heute in Frankreich lebenden Romanautorin Scholastique Mukasonga, die als Opfer der inländischen Deportationen früherer Jahrzehnte und schließlich als Überlebende des Tutsizids von ihrer Kindheit und Jugend erzählt,16 kann hier herangezogen werden: Mukasonga ist der Überzeugung, eigentlich habe der Tutsizid schon 1959 begonnen – aber eben schleichend, mit Momenten des Anschwellens und wieder Abflauens, rückblickend aber erkennbar als ein kontinuierlicher Prozess, der bis 1994 nie wieder zum Stillstand gekommen sei.17
Auch die oben zitierte Aussage von Elie weist in diese Richtung. Er nimmt die Vorgeschichte des Tutsizids als eine zyklische wahr. „Heiße“ und „nicht so heiße“ Jahre werden unterschieden. Es wird so getan, als handle es sich um die Übertragung meteorologischer Phänomene, die für die Arbeit der Bauern und ihre Ernteergebnisse entscheidend waren, auf die gemeinsam unternommenen Mordaktionen. Diese Selbstdarstellung betont implizit, man habe sozusagen gar nichts ‚Besonderes‘ getan. Indem die ‚Bäuerlichkeit‘ und ‚primitiven‘ Ausstattung eines Apparates hervorgehoben werden, der sich sozusagen ‚im Einklang mit der Natur‘ befunden habe, wird die sorgfältige Organisation verschwiegen, die dem Genozid voranging: Die Schaffung der Miliz der Interahamwe, der Aufkauf und die Austeilung von Stich-Waffen, die Erstellung von Namenslisten, die Nutzung des Hate-Radios zur ideologischen ‚Einstimmung‘ bleiben gänzlich unerwähnt.
Jean Hatzfeld hat dann mit Hilfe eines Übersetzers den Kontakt zu weiteren Männern gesucht – nämlich zu Freunden von Elie, die sich sämtlich in Nyamata an Tötungen beteiligt hatten. Es ging dem Journalisten darum, die spezifischen Interaktionen in einer bäuerlichen Region zu verstehen. In dieser hatte die Interahamwe, ganz so wie in vielen anderen Gegenden, als Initialzündung und ‚Lehrmeister‘ gewirkt. Zugleich war aber in dieser Gegend schnell auch eine gewisse ‚Autonomie‘ der bäuerlichen Tötungseinheiten zu beobachten gewesen.
Mein eigenes Vorhaben besteht darin, die Täter in ihren Aussagen als Individuen ernst zu nehmen, d.h. von einer gewissen Bandbreite von Mordmotiven und Selbst-Wahrnehmungen auszugehen, ohne dabei jedoch den Aspekt des Austauschs und Interagierens zwischen den verschiedenen Männern, hin zu so etwas wie einem gemeinsamen ‚Habitus‘, aus dem Blick zu verlieren.
Eine erste Beobachtung, die, ähnlich wie bei Elie, auf eine gewisse Gleichartigkeit zwischen vor-genozidalem Alltag und Genozid hinweist, betrifft die Selbstbeschreibung derer, die nicht etwa als Lehrer, Militärs oder Geschäftsleute tätig gewesen waren, sondern wie die große Mehrheit als Bauern ihren Acker zu bestellen pflegten. Hatzfeld zeigt, dass es zum Teil schwierig für sie war, sich über makropolitische Zusammenhänge zu informieren. Andererseits gab es Anführer, die räumlich mobil waren und Informationen aus anderen Landesteilen verbreiteten. Es ist Alphonse, ein weiterer Hutu, der betont:
On ne changeait pas nos habitudes de lever de cultivateurs, sauf pour l’heure, qui pouvait être plus tôt ou plus tard selon les péripéties de la veille. (Alphonse Hittyaremye in Hatzfeld 2003: 16) Wir änderten unsere Gewohnheiten als Bauern nicht, nur bezüglich der Uhrzeit, die je nach den Ereignissen des Vortags mal früher, mal später liegen konnte. [Übersetzung A.P.]
Der euphemistische Ausdruck, dessen man sich in Ruanda schon seit Jahrzehnten zu bedienen pflegte, wenn es darum ging, zu töten, ist bereits in dieser Aussage impliziert: Es ging, so Alphonse, ums ‚Arbeiten‘ (vgl. Mujawayo/Belhaddad 2011) und ‚An-die-Arbeit-Gehen‘, und dies geschah unter Berücksichtigung einer gewissen Regelmäßigkeit, ohne die es zu keinen ‚Arbeitsergebnissen‘ hätte kommen können. Darauf antwortet wie ein Echo Elie:
On devait faire vite, on n'avait pas droit aux congés, surtout pas les dimanches, on devait terminer. On avait supprimé toutes les cérémonies. On était tous embauchés à égalité pour un seul boulot, abattre tous les cancrelats. Les intimidateurs ne nous proposaient qu'un objectif et qu'une manière de l'atteindre. [...] Je ne sais pas comment c'était organisé dans les autres régions, chez nous c'était élémentaire. (Elie Mizinge in Hatzfeld 2003: 19) Wir mussten uns beeilen, wir hatten kein Anrecht auf Ferien, vor allen Dingen sonntags nicht, wir mussten’s zuende führen. Wir hatten alle Zeremonien unterdrückt. Wir waren alle gleichermaßen für einen einzigen Job eingestellt, den nämlich, alle Käfer auszulöschen. Die Einschüchterer boten uns nur ein einziges Ziel und eine einzige Art an, dieses zu erreichen. [...] Ich weiß nicht, wie das in anderen Gegenden organisiert war, bei uns wars ganz einfach. [Übersetzung A.P.]
Elie Mizinge bestätigt, was auch schon sein Mit-Häftling zu Protokoll gegeben hatte: Der Genozid kam einem kollektiven Engagement gleich, das von organisatorischen ‚Notwendigkeiten‘ bestimmt gewesen sei. Erneut wird die ‚Einfachheit‘ des kollektiven Tuns hervorgehoben. ‚Gearbeitet‘ wurde, um eine lange zuvor begonnene ‚Insektenvernichtung‘ zum Abschluss zu bringen; gearbeitet wurde in der Erwartung, dass sich niemand von diesem ‚Gemeinschaftswerk‘ ausschließen würde. Wie lange und wie regelmäßig an jedem Tag zu ‚arbeiten‘ war, hing nicht mehr vom Belieben des Einzelnen und seinem bisherigen Verhältnis zur Arbeit ab. Vielmehr war es das Telos derselben, das die jeweiligen Regeln vorgab.
Der Verzicht auf Ruhezeiten, der sich in Elie Mizinges Erinnerung an den Genozid besonders eingeschrieben hat, schien der Zustimmung bezüglich des angestrebten Ziels entsprungen zu sein.18 Wenn die Tutsi einer ‚Endlösung‘ zugeführt und aus Ruanda ein ‚tutsifreies‘ Land gemacht werden sollte, war es ‚evident‘, dass auf die Sonntagsruhe verzichtet werden musste. In dem Moment, in dem beschlossen worden war, dass die Arbeit nicht nur ‚Stückwerk‘ bleiben, sondern dass sie auf Totalität ausgerichtet war, musste gleichsam auch die Arbeitsbereitschaft eine totale werden.19
Wichtig an dieser Auffassung vom Töten war, dass mit seinem Beginn schon sein Ende vorweggenommen war.20 Der Genozid dachte sich von der Antizipation dessen her, was erreicht werden wollte. Eile schien geboten, weil dies jetzt nicht nur schlicht eine ‚heiße‘ oder ‚hitzige Jahreszeit‘ wie in der Vergangenheit war, sondern die entscheidende, ‚letzte‘ überhaupt: Dieses Mal sollten die Tutsi wirklich ‚bis zum Letzten‘ vernichtet werden.21
In einem ersten Schritt ist also festzuhalten, dass auf Seiten mancher Mörder die gleichsam ‚uneigennützige‘ Bereitschaft existierte, den Vernichtungsapparat als Mittel zur Erreichung eines ‚höheren Zwecks‘ zu betrachten, welcher es rechtfertige, die Normalität und Regelmäßigkeit eines bäuerlichen Arbeitsrhythmus um etwas ‚Extra-Ordinäres‘, ‚Außergewöhnliches‘ zu erweitern: nämlich um die Sonntagsarbeit.
2. Entheiligungsprozesse
Dass diese Entscheidung nicht zuletzt mit den Orten zusammehing, an denen im ganzen Land besonders viel und schnell getötet wurde, geht aus dem obigen Zeugnis nur indirekt hervor. Zu erinnern ist an die Tatsache, dass die christliche Missionierung, die in der Kolonialzeit erst durch deutsche, dann belgische sowie französische Geistliche betrieben wurde, in Ruanda im Endergebnis besonders ‚erfolgreich‘ gewesen war. Der Christianisierungsgrad Ruandas war der höchste von ganz Afrika, so dass kirchliche Autoritäten aufgrund der zentralen Bedeutung, die sie dann auch im Schul- und Bildungssektor spielten, eine gesellschaftlich wie politisch anerkannte Instanz darstellten. Die große Wertschätzung der beiden christlichen Konfessionen hatte sich in der Geschichte der Massaker seit 1959 folglich auch darin bemerkbar gemacht, dass das Innere von Kirchengebäuden als Zufluchtsstätten für verfolgte Tutsi respektiert wurde. Getötet wurde überall, doch die Kirchen mit ihren Altären galten bis 1994 weitgehend als sakrosankt.
Im Genozid sollte sich aber auch dies mit schlagartiger Plötzlichkeit ändern. Da die Kirchen der Tutsi zum Teil aus eigener Entscheidung, zum Teil auf Befehl der Autoritäten aufgesucht wurden, um Schutz zu finden, entstanden Orte, in denen sich große Massen von Menschen konzentrierten. Das Vertrauen auf die Heiligkeit der Kirchen erwies sich aber plötzlich als organisatorischer Vorteil für die Mörder: Es konnte jetzt mit Granaten und Feuer getötet werden (vgl. Human Rights Watch 1995), und wenn die Schusswaffen fehlten, bestand die ‚Arbeitserleichterung‘ in jedem Fall darin, dass die Menschen, die sich in den Kirchen zusammengedrängt sahen, den Macheten ihrer Nachbar:innen nicht mehr entkommen konnten.22 Alle Institutionen und Apparate, die zur ‚Verwestlichung‘ der ruandischen Gesellschaft beigetragen hatten, sind demnach für das genozidale Projekt missbraucht worden. Neben Kirchen fungierten auch Schulen oder der Rundfunk als Instrumente, die im Dienst des Genozids standen. Das Konzept des „landwirtschaftlichen Genozids“ muss also dialektisch verwendet werden. Es kann keineswegs darum gehen, die Massaker nur als Ergebnis eines bäuerlichen Lebens darzustellen. Für die Selbstdarstellung und die perversen ‚Entschuldungs‘-Versuche der Täter war jedoch dieser Interpretationsstrang sehr wichtig.
Dass der oben Befragte wie nebenher auf die Fortsetzung der ‚Arbeit‘ an Sonntagen hinweist, ist also nicht allein als Zeichen für die Totalität des ‚Engagements‘ zu werten, das die Männer beweisen wollten, sondern muss auch als Abwehr des Zweifels bezüglich der Frage gelten, wie sich der eigene Glaube mit dem ‚Tötungshandwerk‘ vereinbaren lasse. Sonntags zum Töten auszuziehen, hieß gleichsam, eine ‚Pause‘ bezüglich des Christseins einzulegen. Gottesdienste konnten nicht länger gefeiert werden, weil die Kirchen voller Leichen lagen. Es war also, so impliziert Elie Mizinge, völlig logisch, dass das bäuerliche ‚know-how‘ ohne sonntägliche Unterbrechung weiterbetrieben werden musste.
3. Die Selbsttätigkeit der Werkzeuge
Das ‚know how‘ ist aber auch darum als besonders wichtiges Element zu betrachten, weil man sich nur so dem internen Funktionieren der genozidalen Akteure nähern kann. Zu diesem Thema haben sich im Gespräch mit Jean Hatzfeld gleich mehrere Täter geäußert. Erneut geht Elie Mizinge seinen ‚Kollegen‘ voran, indem er beschreibt, welches Verhältnis in bäuerlichen Familien zur Machete bestand.
Le gourdin c’est plus cassant, mais la machette est plus naturelle. Le Rwandais est familiarisé avec la machette depuis l’enfance. Attraper une machette à la main, c’est ce qu’on fait chaque matin. On coupe les sorghos, on taille les bananeries, on défriche les lianes, on tue les poulets. Mêmes les femmes et les petites filles empruntent la machette pour de menues corvées, comme casser le bois de cuisson. C’est le même geste pour différentes utilités qui ne nous désoriente jamais. Le fer, quand tu t’en sers pour couper la branche, l’animal ou l’homme, il ne dit pas un mot. (Elie Mizinge in Hatzfeld 2003: 41) Der Knüppel zerschlägt stärker, doch die Machete ist natürlicher. Der Ruander ist von Kindheit an mit der Machete vertraut. Eine Machete in die Hand zu nehmen, ist das, was man jeden Morgen tut. Man schneidet die Sorghopflanzen, man schneidet den Bananenhain, man rodet die Lianen, man tötet die Hühner. Sogar die Frauen und kleinen Mädchen leihen sich für kleinere Aufgaben die Machete aus, beispielsweise um Holz zum Kochen zu spalten. Es handelt sich um die gleiche Geste mit verschiedenem Nutzen, und wir fühlen uns bei ihr niemals unsicher. Das Eisen, wenn Du Dich seiner bedienst, um einen Ast, ein Tier oder einen Menschen zu schneiden, sagt kein Wort. [Übersetzung A.P.]
Diese Aussage ist, so schwer auch die Gleichsetzung von Ast, Tier und Mensch als Objekt des Zerhackens zu ertragen ist, von paradigmatischer Bedeutung. Augenscheinlich wird, dass Elie Mizinge der Überzeugung ist, etwas, was man zu tun verstehe, entwickele eine Art von Eigendynamik. Weil der Umgang mit der Machete, so die Behauptung, schon in der Kindheit erlernt werde, werde die Frage, was dann jeweils unter das Werkzeug gerät, völlig nebensächlich. Egal, ob es sich beim Roden um einen Ast, beim Schlachten um den Kopf eines Huhns oder im Genozid um die Extremitäten der Nachbar:innen handelt, die dem rassistischen Setting nach (vgl. Chrétien 1999) als ‚zu groß‘, ‚zu hoch aufragend‘, ‚zu überlegen‘, d.h. als ‚zu Zerhackendes‘ galten – zugeschlagen wurde unter Hinweis auf das Argument, man folge der immer gleichen, schon existierenden ‚Kennerschaft‘.
Dass das Ziel dann nicht allein darin bestand, die vermeintlichen ‚Feinde‘ vom Leben zum Tod zu befördern, sondern vielmehr auch darin, ihnen, wo möglich, ein langes, qualvolles, sich über Minuten, Stunden, ja Tage hinziehendes Sterben zuzufügen, wird von Elie Mizinge nicht eigens erwähnt. Das hat damit zu tun, dass sich dies seinem Interesse für die ‚Kontinuitäten‘ zwischen dem ‚Zuvor‘ und dem Genozid entzieht. Tatsache ist jedoch, dass die Berufung auf die Vertrautheit des Werkzeugs jedes Bewusstsein für das, was mit diesem geschieht, auslöscht.
Es entsteht der Eindruck, dass Elie Mizinge die Handhabung der Machete gar nicht mehr als etwas empfand, was eine Hand voraussetzte, die sie führte. Vielmehr ergibt sich aus seiner Darstellung eine Umkehrung von Ursache und Folge. Elies Mizinge Text liest sich so, als habe der Besitzer des Werkzeugs dasselbe nicht aus dem Grund verwendet, weil er, der Mensch, entschieden hatte, es zu verwenden. Vielmehr zeichnet sich das Argument ab, das Werkzeug sei, weil seine Verwendung so leicht war, ‚selbsttätig‘ geworden, d.h. habe umgekehrt seinen Inhaber dazu ‚veranlasst‘, der Bewegung zu folgen, die es (nämlich das Werkzeug) vollführen ‚musste‘.23
Nicht Elie Mizinge also verwendete seine Machete, sondern seine Machete verwendete ihn, und zwar mitsamt seiner gewohnheitsmäßigen Geschicklichkeit im Zuschlagen. Nicht eine menschengemachte Absicht führte zum Töten, sondern eine werkzeuginterne Selbstläufigkeit. Man könnte es variierend auch so formulieren: Nicht die Absicht, zu töten, führte dazu, dass man die Machete in die Hand nahm, sondern dass man die Machete immer schon in der Hand gehabt habe, führte eine Situation herbei, in der man mit Hilfe des Werkzeugs dann auch einmal vertraute Menschen töten konnte (vgl. Peiter 2024).
Eine Beiläufigkeit entstand, die der Beiläufigkeit des Rodens oder Hühnerschlachtens entsprach. Zur Wirkung kam es, weil das Werkzeug die Ursache in sich aufgesaugt hatte, und dass der Mensch sich daher nicht länger als Ursache für die Massaker sehen musste, erleichterte wiederum die Interpretation, nichts wirklich Außergewöhnliches sei im Frühjahr und Sommer 1994 geschehen.
Der Gedanke von Hannah Arendt, Werkzeuge hätten als Mittel die Fähigkeit, sich gegenüber der Ursache absolut zu setzen, bleibt hier eine Einsicht von bestürzender Allgemeingültigkeit: „[D]er Zweck, der die Mittel bestimmt, die zu seiner Erreichung notwendig sind, wird von den Mitteln überwältigt.“ (Arendt 2000: 8) Offenbar ist es so, dass die Fähigkeit, etwas machen zu können, sich in die Unterwerfung des Machen-Müssens wandeln kann, so dass das Ungeheuerlichste einfach nur darum geschieht, weil es geschehen kann. Dass es aber geschehen gemacht worden ist (aktiv also), tritt aus dem Bewusstsein heraus. Ein ‚Es‘ agiert: Das ‚Es‘ eines Werkzeugs, das mitten in die totale Unalltäglichkeit von Dörfern, die plötzlich mit Leichen übersät sind, die Selbstversicherung stellt, man habe, als man einst im Alltag die Machete den Frauen und kleinen Mädchen lieh, auch nichts anderes getan. Die politischen und ideologischen Dispositive der genozidalen Regierung verstärkten diese Tendenz.
4. Erzieherische Fragen
Der Bezug auf die Familienmitglieder, von denen, kultur- und altersbedingt, angenommen werden durfte, dass sie keine Werkzeug-Nutzer:innen sein würden, muss in diesem Zusammenhang ernst genommen werden. Es ist durchaus kein Zufall, dass die Relativierung des eigenen Tuns und der eigenen Verantwortung nicht nur durch die Hervorhebung der Vertrautheit im Umgang mit Werkzeugen betrieben wird, sondern auch durch den Hinweis auf weibliche Kinder. Natürlich geht es Elie Mizinge bei der Erwähnung des Holzhackens in erster Linie um eine Beschreibung des bäuerlichen Alltags. Doch in dem Moment, in dem das Holzhacken, mit dem die Jüngsten beauftragt werden, in Parallele gesetzt wird zum Zerhacken von Menschen, das mit demselben Werkzeug erfolgte, deutet sich, ähnlich wie mit Blick auf das durchbrochene Tabu des Tötens in Kirchen, eine weitere Zäsur an.
Die Beteiligung von Kindern am Genozid gehört zu den Themen, von denen die eigentlichen Mörder gar nicht, die Frauen wiederum nur verhohlen, wie hinter vorgehaltener Hand, zu berichten wagten. Clémentine Murebwayre, eine Hutu und zugleich Frau eines Tutsi (vgl. Hatzfeld 2003: 35), gehörte zu den wenigen, die mit einer gewissen Exaktheit von einem ‚Lernen‘ berichteten, das nicht nur vom Hacken des Brennholzes durch Kinder zum Mord durch Erwachsene führte, sondern umgekehrt auch von den Morden der Erwachsene hin zu ‚Lektionen‘, die dann auch den Kindern das Morden ermöglichen sollten.
J’ai vu des papas qui enseignaient à leurs garçons comment couper. Ils leur faisaient imiter les gestes de machette. Ils montraient leur savoir-faire sur des personnes mortes, ou sur des personnes vivantes qu’ils avaient capturées dans la journée. Le plus souvent les garçons s’essayaient sur des enfants, rapport à leurs tailles correspondantes. Mais le grand nombre ne voulait pas mêler directement les enfants à ces saletés de sang, sauf à regarder, bien sûr. (Clémentine Murebwayre in Hatzfeld 2003: 44f.) Ich habe Papas gesehen, die ihren Jungen beibrachten, wie man schneide. Sie ließen sie die Gesten mit der Machete nachmachen. Sie zeigten ihr know-how an toten Personen oder an lebendigen Personen, die sich an diesem Tag gefangen hatten. Meistens versuchten sich die Jungen wegen ihrer entsprechenden Körpergröße an anderen Kindern. Doch die meisten wollten die Kinder nicht in diesen Schmutz des Blutes hineinziehen, abgesehen vom Zusehen natürlich. [Übersetzung A.P.]
Dass die genozidale Dynamik nicht nur vom einstigen Alltag der Erwachsenen hin zur Veralltäglichung des Tötens führte, sondern auch die Kinder in die Behauptung einbezog, eigentlich müssten doch auch sie verstehen können, was sie im Alltag (d.h. im Umgang mit der Machete) längst verstanden hätten, ist an Furchtbarkeit und Grausamkeit schwerlich zu überbieten. Väter, die Bauern sind, wünschen, dass ihre Söhne Bauern werden. Väter, die die Machete zu handhaben verstehen, wünschen, dass auch ihre Söhne dies verstehen, und zwar unabhängig vom je verfolgten Zweck und ‚Nutzen‘. Männliche Kinder wachsen in den elterlichen Beruf hinein, und wenn dieser Beruf dann plötzlich der Berufs des Mordens ist, folgt der Unterricht dem Prinzip, dass die zu ‚Objekten‘ degradierten Opfer der Größe der Lernenden anzupassen sei. So wie kleine Mädchen nicht gleich einen ganzen Baum fällen, sondern mit den Holzscheiten für die Küche beginnen, so beginnen dann auch die kleinen Jungen nicht mit dem Töten von erwachsenen Tutsi, sondern mit deren Kindern.
Clémentine erwähnt, dass hier für viele Hutu-Familien eine ungeschriebene Grenze erreicht worden sei, d.h. dass die ‚Veralltäglichung‘ des Mordens sich nicht in allen Familien auf die männlichen Kinder ausgedehnt habe. Zugleich unterliegt aber auch diese Frau, obwohl in Ansätzen ‚erziehungs‘- und ‚genozid-kritisch‘ argumentierend, der Normalisierungslogik, von der alles Bäuerliche und Berufliche erfasst wird. Die Zeugin benutzt nämlich das Wort ‚natürlich‘, um klarzustellen, dass das Zuschauen von Seiten der Kinder eine gängige Praxis dargestellt habe.
Dieses Wort kann nun in zweierlei Hinsicht benutzt werden. Eine erste Interpretation besagt, Clémentine verwende es nicht in apologetischer Hinsicht, sondern pragmatisch-realistisch. Das soll heißen, dass sie schlicht beschreibt, wie es ablief. Da es sich beim Tutsizid um einen ‚Genozid der Nähe‘ handelte, bei dem in der Regel im allerkleinsten Umkreis des eigenen Dorfes und dessen Feldern und Wäldern getötet wurde, konnte es gar nicht anders sein: Kinder wurden, egal ob gewollt oder nicht gewollt, notwendigerweise zu Zeugen dessen, was geschah (vgl. Dumas 2014b; 2000).
Die zweite Interpretation ist pessimistischer. Vielleicht ist der Zusatz, ‚natürlich‘ sei es zur Augenzeugenschaft der Jüngsten gekommen, als graduelle Abschwächung von dem gemeint, was Clémentine augenscheinlich nicht mittragen mochte: Dass Kinder zusahen, mochte in der ‚Ordnung der Dinge‘ liegen; dass sie selbst tötend in Erscheinung traten, war für sie hingegen ‚nicht in Ordnung‘.
Dass auch die ‚bloß‘ zusehende Teilhabe am Genozid schon zu dem hinleitete, was Elie Mizinge zuvor über Rodungs- und Schlachtungsarbeiten ausgeführt hatte, stand nicht in Frage: ‚Natürlich‘ war ein Lernen, das auf Nachahmung beruhte, in einem ersten Schritt zunächst einmal ein Lernen des ‚Dabeiseins‘ und Zusehens. Der zweite Schritt, nämlich das ‚Mitmachen‘ als ‚Nachmachen‘, war aber in diesem ersten schon enthalten. Insofern kann mit Blick auf das Konzept des ‚landwirtschaftlichen Genozids‘ von einer regelrechten, informellen ‚Landwirtschaftsschule‘ gesprochen werden, als deren Lehrmeister die Erwachsenen und als deren Schülerschaft die Kinder auftraten. Hinzu kam die ‚normale‘ Schule. Die Kinder sollten in der Gegenwart und mit Blick auf die Zukunft lernen, die Tutsi zu hassen und schließlich zu töten. Symptomatisch für dieses Vorhaben ist die Einbeziehung von Schulinstitutionen in den Völkermord, und zwar durch die einschlägige Propaganda sowie die jahrzehntelange Marginalisierung der Opfer.
Da während des Genozids die Schulpflicht kurzerhand für inkompatibel mit den neuen (und zugleich alten) ‚Berufen‘ der Eltern erklärt wurde, ist zugleich die Ablösung der einen, nämlich ‚normalen‘ Schule durch eine neue, andere, nicht-normale zu konstatieren. In gewißer Weise entsprach die Tatsache, dass die Hutu-Kinder seit dem April 1994 nicht mehr zur Schule gingen (und die Tutsi-Kinder ‚natürlich‘ sowieso nicht), aber auch einer bestimmten Wirkung der Politik. Diese hatte bewirkt, dass Tutsi-Kinder in der Schule durch die herrschenden Quoten-Regelungen jahrzehntelang systematisch diskriminiert worden waren (vgl. Mugesera 2014). Dass ein Tutsi-Kind eine weiterführende Schule besuchen konnte, war eine seltene Ausnahme, die denn auch von Verwandten, ja dem gesamten Dorf in großen, kollektiven Festen als das ganz und gar Unerwartbare gefeiert zu werden pflegte.24
5. Die Angst der Ziegen
Dass neben den Hühnern als Tierwelt der kleinen, von Familien betriebenen Bauernhöfe von den Tätern auch Ziegen erwähnt wurden, um Hatzfeld, dem Franzosen, der zuhört, klar zu machen, was in den ‚hundert Tagen der Machete‘ genau geschah, führt uns jetzt schrittweise zu ganz anderen Festen, die dieses Mal auf Seiten der Hutu-Familien gefeiert wurden. Pio Muturingehe, ein weiterer, zu Gefängnishaft verurteilter Täter, erzählt, warum das Töten so einfach gewesen sei. Es seien, so sein Urteil, die Tutsi selbst gewesen, die bewirkt hätten, dass die Mörder das Morden gar nicht als solches wahrgenommen hätten.
On tuait comme on savait, comme on le ressentait, chacun prenait sa vitesse. Il n’y avait pas de consignes sérieuses pour le savoir-faire, sauf celle de continuer. Et puis, il faut préciser un fait remarquable qui nous a encouragés. Beaucoup de Tutsi ont montré une terrible peur d’être tués, avant même qu’on commence à les frapper. Ils cessaient leur agitation dérangeante. Ils se plantaient immobiles ou se blottissaient. Alors, cette attitude craintive nous a aidés à les frapper. C’est plus tentant de tuer une chèvre bêlante et tremblante qu’une chèvre fougueuse et sauteuse, si je puis dire. (Pio Muturingehe in Hatzfeld 2003: 42) Wir töteten, so gut wir’s verstanden, wie wir’s empfanden, jeder folgte seinem Tempo. Es gab keine ernsthaften Vorgaben für das know-how, bis auf die Vorgabe, weiterzumachen. Und dann gab es eine bemerkenswerte Tatsache, die uns ermutigt hat. Viele Tutsi haben, noch bevor wir überhaupt anfingen, sie zu schlagen, eine furchtbare Angst gezeigt, getötet zu werden. Sie stellten ihre störende Aufgeregtheit ein. Sie blieben bewegungslos an einer Stelle stehen oder scharten sich zusammen. Diese ängstliche Haltung hat uns dann sehr geholfen, sie zu schlagen. Es ist einladender, eine meckernde und zitternde Ziege zu töten, wenn ich mal so sagen darf, als eine Ziege, die flieht und herumspringt. [Übersetzung A.P.]
Eine regelrechte Tierschlachtung wird hier als Folie benutzt, um die Erinnerungen an den Tod von Nachbarsfamilien erzählbar zu machen. Während Elie Mizinge noch argumentiert hatte, die tödliche Verwendung der Machete gegen Menschen sei einfach gewesen, weil man mit der Verwendung der Machete zwecks Schlachtung von Hühnern vertraut gewesen sei, tritt hier zu der gleichsam ‚technischen‘ Frage eine psychologische hinzu. Am Beispiel einer Ziege wird deutlich gemacht, dass es aus Sicht des Schlächters unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beim Töten gab.
Das Entsetzliche des Vergleichs zwischen Mensch und Ziege besteht darin, dass implizit behauptet wird, das Töten sei nicht nur mehr oder weniger behindert worden, sondern mehr noch: der fehlende Widerstand der Tutsi habe das Töten geradezu hervorgerufen. Pio Muturingehes Darstellung ist gekennzeichnet durch eine Umkehr der Rollen von Tätern und Opfern in dem Sinne, dass alles, was die Opfer taten (oder eben auch nicht taten), mit Blick auf das eigene Tun und Töten ausgelegt wird. Ein Opfer, das sich nicht wehrte, hatte gleichsam den Täter dazu ‚eingeladen‘, die ausbleibende Gegenwehr als ‚natürliche‘ Wehrlosigkeit zu deuten, und die ‚Natürlichkeit‘ der Wehrlosigkeit wurde dann ihrerseits mit der vom Opfer ausgehenden Aufforderung gleichgesetzt, dann auch wirklich zuzuschlagen.
Pio Muturingehes perverse Konzentration auf die Wirkung, die die Angst seiner Opfer auf ihn ausgeübt hatte, geht so weit, dass die These aufgestellt werden kann, eigentlich liege die Schuld am Getötet-worden-Sein bei den Getöteten und nicht etwa bei den Tötenden. Als ‚Grund‘ nennt der Täter die Tatsache, dass die Tutsi schon Zeichen von Angst zeigten, als er noch gar nicht zugeschlagen habe. Die totale Unfähigkeit, sich wenigstens rückblickend in die Situation der Opfer zu versetzen, tritt auf grauenvolle Weise zu Tage.
Pio Muturingehes Zeugnis zeigt, dass er keinen Begriff davon hat, wie das Schicksal von bereits Getöteten die Angst verstärkte, die die noch ‚Verschonten‘, ‚Übriggebliebenen‘ empfanden. Dass Tutsi, sofern sie Geld besaßen, immer wieder versucht haben, sich einen ‚schnellen‘, ‚gnädigen‘ Tod zu erkaufen25, gehört zur bereits erwähnten Geschichte der ausgesuchten Grausamkeit, bei der Amputationen als Mittel langer Agonien benutzt zu werden pflegten.
Das, was Hannah Arendt beim Blick auf Adolf Eichmanns Jerusalemer Glaskäfig als die ‚Phantasielosigkeit‘ der ‚Schreibtischtäter‘ konstatiert hat (vgl. Arendt 2001), lässt sich offenbar auch anwenden auf diejenigen, die nicht auf bürokratische Weise am ruandischen Vernichtungsapparat beteiligt waren, sondern konkret als Tötende. Menschen umgebracht zu haben und Zeuge ihrer Angst geworden zu sein, hieß keineswegs, Angst nachempfinden zu können. Pio Muturingehe ist ein Beispiel für eine Fühllosigkeit, die wirklich Ziegen und Menschen als identisch wahrnahm. Symptomatisch ist hier die rhetorische Dimension des Vergleiches: Die Opfer gelten nicht länger als ‚Kakerlaken‘, sondern werden nur noch als Haustiere wie ‚Hühner‘ und ‚Ziegen‘ klassifiziert. Die Thesen des Täters weisen eine stark retrospektive Dimension auf. Temporalitäten spielen in der Konstruktion des Feindbildes ohnehin eine große Rolle – und das gilt auch für die postgenozidale Gesellschaft Ruandas (vgl. Peiter 2023).
Ein Handeln, das nur und ausschließlich von dem ausgeht, was das Werkzeug könne, wird demnach begleitet von einer psychologischen Haltung, die unfähig ist, die Funktionsweise von Angstgefühlen nachzuvollziehen. Léopord Twagirayezu, ein weiterer Mörder, legt, vor Hatzfelds Mikrophon sitzend, dieselbe Schlussfolgerung nahe. Auch er argumentiert vom Werkzeug her, auch er findet, dass das Töten ganz einfach gewesen sei:
Moi, je n’ai pris que la machette. Premièrement parce que j’en possédais une à la maison, deuxièmement parce que je savais l’utiliser. Pour celui qui est habile au maniement d’un outil, c’est facile de l’utiliser pour toutes les activités; tailler les plantations ou tuer dans les marais. (Léopord Twagirayezu in Hatzfeld 2003: 43) Ich selbst habe nur die Machete genommen. Erstens, weil ich eine Zuhause besaß, zweitens, weil ich mit ihr umzugehen verstand. Für denjenigen, der im Umgang mit einem Werkzeug geschickt ist, ist es einfach, es für alle Aktivitäten zu benutzen; Anpflanzungen zu beschneiden oder in den Sümpfen zu töten. [Übersetzung A.P.]
Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Léopord wirklich eine Machete besaß. Entscheidend ist jedoch all das, was verschwiegen wird: Der staatlich gesteuerte Import dieser Waffen sollte aus ihrer Verfügbarkeit ein flächendeckendes Phänomen machen.
6. Potlatschartige Feste
Und dann ist es wiederum Pio Muturingehe, der noch einmal diese vom Beschweigen grundierte Auffassung Léopords bestätigt:
La culture, c’est plus simple parce que c’est notre métier de toujours. Les chasses étaient plus imprévues. C’était même plus fatigant les jours de grandes opérations, à patrouiller autant de kilomètres derrière les interahamwe, à travers les papyrus et les moustiques. Mais on ne peut pas dire qu’on regrettait les champs. On était plus à l’aise dans ce travail de chasse, puisqu’il n’y avait qu’à se baisser pour récolter la nourriture, les tôles et le butin. La tuerie, c’était une activité plus brusquante mais plus valorisante. La preuve, personne n’a jamais demandé la permission d’aller débrousailler sa parcelle, même une demi-journée. (Pio Muturingehe in Hatzfeld 2003: 71) Ackerbau ist einfacher, weil dies von jeher unser Beruf ist. Die Jagden waren unvorhergesehener. Das war an den Tagen der großen Operationen, an denen wir hinter den Interahamwe kilometerweit durch den Papyrus und die Mücken hindurch patrouillieren mussten, sogar ermüdender. Doch man kann nicht sagen, dass wir die Felder vermissten. Wir fühlten uns bei dieser Arbeit des Jagens wohler, weil wir uns nur zu bücken brauchten, um die Nahrung, die Wellblechdächer und die Beute zu ernten. Das Töten, das war eine heftigere, aber dem Ansehen stärker förderliche Tätigkeit. Der Beweis: Niemand hat je um die Genehmigung gebeten, sein Feld vom Gestrüpp zu befreien, noch nicht mal für einen halben Tag. [Übersetzung A.P.]
Wie sehr auch hier in Kontinuitäten von Berufskategorien gedacht wird, ist mit Händen zu greifen. Pio Muturingehe beschreibt sich selbst als einen Mann, der sich vom Bauern in einen ‚Jäger‘ verwandelt habe und habe verwandeln müssen – eben weil die Opfer versuchten, den Massakern zu entkommen. In der Nähe des Ortes Nyamata, in dem Pio Muturingehe Zuhause war, gab es Sümpfe, und diese dienten denjenigen, die den ersten Tagen lebend entkommen waren, als Versteck.
Aus Pio Muturingehes Zeugnis spricht außerdem etwas gänzlich Neues, das in dialektischen Gegensatz zur bisherigen Kontinuitätsthese tritt. Bisher war die Selbstwahrnehmung der Täter, ihre Selbstinterpretation, ihr Blick auf das vergangene Tun vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Bruchlosigkeit untersucht worden. Jetzt tritt jedoch hervor, dass mit dem Übergang zum Beruf des ‚Jägers‘, der traditionell stets der ‚dritten‘ und zugleich kleinsten ‚Ethnie‘, nämlich den in den Wäldern lebenden ‚Twa‘ zugewiesen worden war, eine tiefgreifende Zäsur im Alltag zu greifen begann. Diese hatte mit den Bereicherungsmöglichkeiten zu tun, die parallel zu den Tötungen verliefen und bei abendlichen Zusammenkünften der Tötungseinheiten und Nachbar:innen in einer mehr oder wenigen konfliktreichen Verteilung der Beute mündeten. Einer der Inhaftierten berichtet: „On commençait la journée par tuer, on terminait la journée par piller. C’était la règle de tuer à l’aller, et de piller au retour“ (Léopord Twagirayezu in Hatzfeld 2009: 97-98). („Wir begannen den Tag mit Töten, wir beendeten den Tag mit Plündern. Es war die Regel, auf dem Hinweg zu töten und auf dem Rückweg zu plündern.“ [Übersetzung A.P.]) Hier tritt die materielle Dimension des Tötens zu Tage. Plötzlich erübrigten sich Sorgen um die Weiterführung der normalen bäuerlichen Aktivitäten.
Pio Muturingehe stellt die Plünderungen in der Tat mit Begriffen dar, die semantisch zum Bereich der ‚Ernte‘ gehören. Egal, ob man das Gemüse von den Feldern stahl oder sich widerrechtlich die Wellblechdächer von den Häusern der Getöteten zueigen machte – immer war es, als ‚brauchte man sich nur zu bücken‘. Ein potlatschartiger Überfluss wurde erfahren, der, bedingt durch die große Armut der meisten Bauernfamilien, die Form einer einzigen, extatischen, den Alltag transzendierenden Feier annahm. Des Sonntags musste zwar gearbeitet werden, so als wäre dieser Tag ein ‚Werktag‘ wie jeder andere auch – doch zugleich spricht aus Hatzfelds Interviewsammlung die berauschende Erinnerung an Feste, die nach getaner ‚Arbeit‘ Abend für Abend organisiert wurden.
Ein Gefangener namens Adalbert gab gegenüber Hatzfeld zu Protokoll: „On ne parlait plus de cultures entre nous. Les soucis nous avaient délaissés“ (Adalbert Muzingura in Hatzfeld 2003: 68). („Unter uns unterhielten wir uns nicht mehr über den Ackerbau. Die Sorgen hatten uns verlassen.“ [Übersetzung A.P.]) Jean-Baptiste fügte hinzu: „On dormait confortablement, grâce à la bonne alimentation et la fatigue de la journée.“ (Jean-Baptiste Murgangira in Hatzfeld 2003: 67) („Wir schliefen auf komfortable Weise, dank der guten Nahrung und der Anstrengung des Tages.“ [Übersetzung A.P.]) Jean-Baptiste Murgangira, der als Beamter sozial aus der Gruppe hervorstach, hob außerdem hervor, dass auch das Trinken eine wichtige Ingredienz für den Zusammenhalt gewesen sei. Der Rausch gehörte zu den Mitteln, die die Mordbereitschaft verstärken sollten:
Personne ne descendait plus à la parcelle. A quoi bon bêcher, alors qu’on récoltait sans plus travailler, qu’on se rassasiait sans rien élever? La seule besogne était d’enterrer des bananes dans les fosses, au milieu de n’importe quelles bananeraies abandonnées, pour laisser fermenter l’urwagwa des prochaines soirées. On devenait très fainéants. On n’enterrait pas les cadavres, c’était peine gâchée. Sauf bien sûr, si par malchance un Tutsi était tué sur ta parcelle, à cause de la mauvaise odeur, des chiens et des animaux voraces. (Jean-Baptiste Murgangira in Hatzfeld 2003: 67) Niemand ging mehr zu seinen Feldern runter. Warum sollten wir auch umgraben, wenn wir ernten konnten, ohne zu arbeiten, wenn wir uns sättigen konnten, ohne etwas aufzuziehen? Die einzige Pflicht bestand darin, inmitten irgendeines verlassenen Bananenhains in den Gräben die Bananen einzugraben, um das Urwagwa-Bier für die nächsten Abende gären zu lassen. Wir wurden äußerst faul. Wir vergruben die Leichen nicht mehr, das war vergebliche Mühe. Nur dann stellte sich die Situation natürlich anders dar, wenn unglücklicherweise ein Tutsi auf Deiner Parzelle getötet worden war, und zwar wegen des schlechten Geruchs, der Hunde und der gefräßigen Tiere. [Übersetzung A.P.]
Es zeigt sich, dass die Faulheit als die genossene Ausnahme sowie die Missachtung und Gleichgültigkeit, die sich gegen die Körper der Opfer richteten, zusammengehörten. Disziplin und Regellosigkeit, ‚Fleiß‘ beim Töten und ‚Entspannung‘ beim Feiern, ‚Pflichtgefühl‘ zugunsten der ‚Endlösung‘ und ‚Pflichtgefühl‘ bei der Vorbereitung des Bananenbiers hatten Anteil an ein- und demselben Streben nach Gemeinsamkeit (vgl. Dumas 2014a).
Ein letzter Zeuge namens Fulgence erzählt, dass dann auch die Rinder der Tutsi in den Besitz der Hutu gelangt seien. Dies ist insofern eine besonders wichtige Information, weil genau entlang der Schnittstelle zwischen den ‚Besitzern von Herden‘ und ‚Besitzern von Feldern‘ bzw. ‚Hirten‘ und ‚Bauern‘ die ethnischen Zuordnungen der einstigen Kolonialmächte verlaufen waren. Übersehen worden war von den Deutschen wie von den Belgiern, dass die Begriffe ‚Hutu‘ und ‚Tutsi‘ in vorkolonialer Zeit trotz aller divergierenden Rechte und Privilegien von fließenden Grenzen geprägt und vor allen Dingen berufsständisch und nicht etwa rassisch gemeint gewesen waren. Die ‚Rassifizierung‘ bzw. ‚Ethnifizierung‘ der ruandischen Gesellschaft machten jedoch aus den Rindern ein Synonym für die zum Teil völlig imaginäre, zum Teil nur ‚tangenzial‘ mit den Realitäten in Verbindungen stehende, d.h. also zumindest ansatzweise ‚reale‘, soziale ‚Überlegenheit‘ der Tutsi.
Als 1994 neben den Besitzer:innen der Tiere auch die Tiere selbst qualvoll zu Tode gefoltert wurden, ging es darum, in diesen Letzteren auch diejenigen zu treffen, die durchaus nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus kulturellen Gründen die Herden als das Zentrum ihres Lebens betrachtet hatten. Das, was Fulgence im Kontakt mit Hatzfeld zu Protokoll gegeben hat, muss also vor dem Hintergrund dieser kolonial-, kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge gesehen werden:
Pendant les tueries, les avoisinants de passage te déposaient plus que tu ne pouvais mettre dans ta marmite, ça débordait sans rien te compter. La viande devenait aussi négligeable que le manioc. Les Hutus s’étaient toujours sentis frustrés de vaches parce qu’ils ne savaient pas les élever. Ils les disaient pas goûteuses, mais c’était par disette. Raison pour laquelle, pendant les massacres, ils en mangeaient le matin et le soir à cœur joie. (Fulgence Bunani in Hatzfeld 2003: 70) Während der Massaker brachten Dir die Nachbarn mehr vorbei als Du in Deinen Topf tun konntest, das lief über, ohne Dich etwas zu kosten. Das Fleisch wurde genauso bedeutungslos wie der Maniok. Die Hutu waren wegen der Rinder stets frustriert gewesen, weil sie diese nicht aufzuziehen verstanden. Sie sagten von ihnen, sie schmeckten nicht, doch das war wegen der Hungersnot. Während der Massaker aßen sies denn auch des Morgens wie des Abends mit freudigem Herzen. [Übersetzung A.P.]
Die Hutu erhielten also Zugriff auf die vermeintlichen ‚Privilegien‘ der Tutsi, und dies äußerte sich auch körperlich, nämlich in einem Akt der Einverleibung, durch die das Verbrechen dem Genuss, der Mord der Belohnung und die Vernichtung der Aufwertung des Selbstwertgefühls dienten. Das Zeugnis, das Clémentine als eine der wenigen weiblichen Stimmen in Hatzfelds Buch hinterlassen hat, fasst den Eindruck, den die Männer bei ihrer Heimkehr des Abends machten, zusammen:
Les hommes partaient sans savoir ce que serait leur fatigue de journée. Toutefois ils savaient ce qu’ils allaient ramasser en chemin. Ils revenaient avec des visages fatigués mais riants, ils s’envoyaient des rigolades comme dans les saisons de pleines récoltes. Il se voyait à leurs airs qu’ils menaient une existence enthousiasmante. Pour les femmes, l’existence était surtout reposante. Elles avaient abandonné les champs et les marchés. Il n’y avait plus à planter, à manier la batte sur les haricots et à marcher à distance jusqu’au marché. Il suffisait de fouiller pour ramasser. Quand nos défilés de fuyards hutus ont quitté vers le Congo, ils ont laissé derrière eux des parcelles négligées, où la brousse avait déjà mangé plusieurs saisons de labeur du cultivateur. (Clémentine Murebwayre in Hatzfeld 2003: 72) Die Männer brachen auf, ohne zu wissen, worin die Mühe des Tages bestehen würde. Doch sie wussten, was sie auf dem Weg einsammeln würden. Sie kehrten mit müden, doch lachenden Gesichtern zurück, sie warfen sich Scherzworte zu, ganz wie in der Jahreszeit, in der die Ernten voll im Gange waren. Man konnte ihnen ansehen, dass sie ein begeisterndes Leben führten. Für die Frauen war das Leben vor allen Dingen erholsam. Sie hatten die Felder und die Märkte verlassen. Es gab nichts mehr zu pflanzen, die Bohnen mussten nicht mehr gehackt und die Entfernung bis zum Markt nicht mehr zurückgelegt werden. Es reichte aus, Durchsuchungen durchzuführen, um sich Dinge zu holen. Als die fliehenden Hutus in Richtung Kongo aufgebrochen sind, haben sie vernachlässigte Felder hinter sich gelassen, auf denen der Busch mehrere Arbeitsphasen des Bauern zerstört hatte. [Übersetzung A.P.]
Hier kommt zum Vorschein, dass die Kontinuitätsthese, die weiter oben vertreten worden war, durchaus dialektisch betrachtet werden muss. All dem, was gegenüber ‚früher‘ ‚gleich‘ geblieben sei, stand die Erfahrung von ‚Erholung‘, ‚Überfluss‘ und kollektiver Feierlust gegenüber.
7. Kompositorisches und ein Ausblick
Zum Abschluss möchte ich an einigen wenigen Beispielen noch den Prozess der Gewöhnung nachzeichnen, der bis hin zur Langeweile beim Töten führen konnte. Es ist dies der Punkt, an dem dann auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive noch einmal die Frage nach der Komposition von Hatzfelds Buch Kontur gewinnt. Inwieweit geht die Montage, die der Autor im Kontakt zu seinem Interview-Material vornimmt, über die bloße Widergabe hinaus? Kann die Kürzung und die damit einhergehende Verdichtung, die Hatzfelds Arbeit an den Aussagen der Täter kennzeichnen, als Ergänzung zu der tendenziell chronologischen Anlage des Buches gelten? Und wie wirkt dies nun wieder ein auf das, was wir in Ruanda unter ‚criminal minds‘ zu verstehen haben?
Es muss daran erinnert werden, dass Hatzfeld dem ‚ersten Mal‘, d.h. der Erfahrung des ersten Mordes, ein eigenes Kapitel widmet, um gegen Ende des Buches schließlich die Frage nach dem ‚Pardon‘, d.h. dem Verzeihen, zu stellen und zu prüfen, wie die Täter im Gefängnis ihre Zukunft sehen. Es gehen jedoch Stellungnahmen voraus, die der Feldarbeit gewidmet sind. In einem dieser Interviews heißt es:
Au début, c’était une activité moins répétitive que les semailles; elle nous égayait, si je puis dire. Par après, elle était devenue tous les jours pareille. Plus que tout, ça nous manquait de rentrer manger à midi. A midi, on se trouvait souvent très éloignés dans les marais; raison pour laquelle, le déjeuner et le repos qui le suivait ordinairement nous étaient interdits par les autorités. (Alphonse Hittyaremye in Hatzfeld 2003: 67) Zu Anfang war die Aktivität weniger repetitiv als das Aussäen; sie heiterte uns auf, wenn ich mal so sagen darf. Später ist sie jeden Tag gleich geworden. Mehr als alles andere fehlte es uns, zu Mittag nach Hause zurückzukehren, um dort zu essen. Mittags befanden wir uns oft weit draußen in den Sümpfen; das war der Grund, warum uns von den Autoritäten das Mittagessen und die Pause, die diesem normalerweise folgte, verboten wurden. [Übersetzung A.P.]
Das Verdienst von Hatzfelds Buch besteht darin, durch geduldiges Zuhören und die Vertreibung der Langeweile, die wiederum gegen Ende der 1990er Jahre in den Gefängnissen herrschte, in denen die Massenmörder inhaftiert waren, ein Material zusammengetragen zu haben, das die Aussagen der Überlebenden ergänzt. Das Buch Dans le nu de la vie (wörtlich: ‚In der Nacktheit des Lebens‘, vgl. Hatzfeld 2000) enthält die unterschiedlichsten Versuche der Letztgenannten, das schier Unbegreifliche der Gewalt des Jahres 1994 wenigstens in Ansätzen erklärbar zu machen. Umgekehrt kommt dem Buch Une saison des machettes die Funktion des Komplementären zu, weil es darauf zählt, dass die Täter aus dem schlichten Bedürfnis heraus, ihrem Gefängnisalltag etwas Neues abzugewinnen, von sich selbst und ihrem Leben erzählen werden.
Die inhaltliche Zusammenstellung und Montage, die Hatzfeld vorgenommen hat, erlaubt es, individual- wie massenpsychologischer Prozesse nachzuvollziehen. Die Frage nach der Möglichkeit, pünktlich sein Mittagessen einnehmen zu dürfen, entschied mit über den Grad der Motivation beim Töten. Hatzfelds Material ist also, obwohl alle Aussagen im höchsten Maße ‚roh‘ sind, von seiner Komposition her durchaus nicht roh. Die Position, die der Journalist gegenüber den Aussagen bezieht, mit denen er sich im Gefängnis von Rilima konfrontiert sah, drückt sich nicht allein in den kommentierenden Kapiteln aus, die zwischen die Interviewblöcke geschaltet sind. Vielmehr äußert sich Hatzfelds Bedürfnis, eine Art Kontrolle über das Unerträgliche der Selbstzufriedenheit und Rachelüste zu gewinnen, die fast alle Täter kennzeichnen, in dem gestaltenden Zugriff auf dieses Material. Was die Männer gesagt haben, bleibt unangetastet. Doch in welcher Reihenfolge sie es sagen und im Rahmen welches thematischen Blockes, das unterliegt der Entscheidung Hatzfelds. Dadurch werden natürlich erste Interpretationsansätze nahegelegt. Die Montage ist Teil der Aussage.
Abschließend stellt sich die Frage nach dem Kollektivbiographischen und der Einbettung der hier vorgeschlagenen Analysen in die Genozid-Forschung allgemein. Wie auch mit Blick auf die Shoah muss hervorgehoben werden, dass Beschleunigungs- und Radikalisierungsprozesse, hin zum Genozid, ohne die Katalysatorwirkung des Krieges schwerlich gedacht werden konnten. Der Sprung der Gewalt in eine neue, zerstörerische Dimension kam durch die kriegsbedingte Unterscheidung der Gruppe des ‚Wir‘ und der Gruppe des ‚Ihr‘, von denen nur eine einzige leben könne, zustande.
Hinzu kam der Kontext eines autoritär-diktatorischen Regimes, das mit Hilfe einer Politik des Terrors und der Ausgrenzung eine allmähliche Enthumanisierung und Animalisierung der designierten Opfer vorantrieb.
Es gibt noch ein weiteres Element, das davor warnt, den Tutsizid gleichsam ‚als das ganz Fremde‘ aus der Geschichte der ‚westlichen Welt‘ oder gar der menschlichen Gemeinschaft schlechthin auszuklammern. Gemeint ist die rassistische Absonderung der Tutsi. Diese ist in einer europäisch-ruandischen (vor allen Dingen germano-franko-belgischen) Verflechtungsgeschichte entstanden, ohne die die ‚hamitischen Theorien‘ niemals zur ideologischen Grundlage von derart eskalierenden Konflikten hätten werden können.
Dass in Ruanda das Radio bei der Indoktrinierung der Gesellschaft im rassistischen Sinne eine kaum zu überschätzende Rolle gespielt hat, ist ein Faktum, das davor warnen sollte, den Tutsizid als gleichsam ‚archaisch-atavistische‘ Gewalt zu beschreiben. Von ihren Organisations- und Koordinationsformen war der Genozid an den Tutsi eine durchweg ‚moderne‘ Erscheinung, so wie auch die begleitenden Identifikations- und Konzentrationsprozesse als Elemente betrachtet werden müssen, die von der europäischen Geschichte der Judenvernichtung her durchaus als vertraut erscheinen.
Zwar kam es in Ruanda nicht zu der ‚Industrialisierung‘ des Tötens wie unter der SS. Doch dass die Eintragungen zur jeweiligen ‚ethnischen Zugehörigkeit‘, wie sie in den Pässen vermerkt war, für die administrative Unterscheidung von ‚Tutsi‘ und ‚Hutu‘ eine außerordentlich große ‚Hilfe‘ darstellten, ist eindeutig. Dies lässt erkennen, dass die einzelnen Täter Teil eines Apparates waren, der lange vor Beginn der Tötungen die organisatorischen Voraussetzungen für den mörderischen Apparat geschaffen hatte. Mit ‚Konzentration‘ ist darüber hinaus die ‚Technik‘ gemeint, mit der die Opfer an bestimmte Orte gezwungen wurden – ein Schritt, der den Mördern ihr ‚Tötungshandwerk‘ erheblich erleichterte und in vielem an die nationalsozialistische Praxis erinnert, ihrer Opfer auf bequeme Weise habhaft zu werden, indem man sie in ‚Judenhäusern‘, Ghettos und schließlich Lagern zusammenpferchte.
Auch in Bezug auf die Aufarbeitungsschwierigkeiten, die auf die Befreiung der Überlebenden folgten, ließe sich bezüglich bestehender Parallelen viel sagen. Betont werden kann hier allein, dass die ruandische Gesellschaft zusammengebrochen wäre, wenn wirklich sämtliche Täter:innen, die sich des Massenmords schuldig gemacht hätten, zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden wären. Eine gewisse ‚realpolitische‘ ‚Pragmatik‘ überwog. Sie war begleitet von Verdrängungs- und Beschweigungsprozessen, die auch durch die Schaffung der so genannten ‚gaçaça‘-Gerichte nicht wirklich ausgehebelt werden konnten.
Blickt man von diesen Verbindungen, die sich zwischen Tutsizid und Shoah ergeben, auf die Aussagen zurück, die in diesem Beitrag im Zentrum standen, so ergeben sich wichtige Einsichten. Es scheint, dass der Blick auf die individual- und gruppenpsychologischen Dynamiken nur vor dem Hintergrund einer sich über lange Zeiträume hinziehenden Vorgeschichte verstanden werden kann. Die ‚criminal minds‘ entstanden nicht als ‚krankhafte Aberration‘ von ‚gestörten Einzelnen‘. Vielmehr waren sie die logische Folge der Amok laufenden Segmente einer Gesellschaft, die sich außerstande sahen, die einmal in Gang gesetzten Beschleunigungsprozesse, die Gewöhnung an Gewalt und die verschwörungsmythische Überzeugung, eigentlich sei man selbst – also der Tötende – das Opfer von äußeren Bedrohungen, zu stoppen.
Als ein Bestandteil des Tutsizids dürfen jedoch die landwirtschaftliche Motivationsstruktur, der damit einhergehende Werkzeuggebrauch und die Rhetorik einer Selbstbeschreibung gelten, die den Versuch, das eigene Tun zu ‚legitimieren‘, in die Sprache der Feldarbeit integrierte. Nicht alle Täter folgten diesen Motiven. Doch für bestimmte Segmente der Mordgemeinschaften war dies der Orientierungsrahmen. Hier ist dann in der Tat ein wesentlicher Unterschied zur Shoah zu verzeichnen. Der Genozid an den Tutsi gewann seine Effizienz dadurch, dass sich Täter und Opfer in den meisten Fällen persönlich kannten. Die Anonymisierung, die in der Shoah der Mehrheitsgesellschaft das Wegsehen erleichtert hat, konnte in Ruanda nicht greifen. Hier waren buchstäblich alle in die Zuschauerrolle geladen.
Literaturverzeichnis
Top of page- Arendt, Hannah (2000). Macht und Gewalt. München, Zürich: Piper-Verlag.
- Arendt, Hannah (2001): Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen. München/Zürich: Piper-Verlag.
- Bärfuss, Lucas (2008): Hundert Tage. Wallstein.
- Bourdieu, Pierre (1996): Les règles de l’art. Paris: Points.
- Coudray, Chloé (2019): Bourdieu, Pierre: L’Habitus. Abgerufen von https://partageonsleco.com/2019/11/06/lhabitus-pierre-bourdieu-fiche-concept/ (20.05.2024).
- Chrétien, Jean-Pierre (1999): Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi, in: Jean-Loup Amselle und Elikia M’Bokolo (Hg.): Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique. Paris: La découverte, S. 129–166.
- Chrétien, Jean-Pierre/Kabanda, Marcel (2016): Rwanda. Racisme et génocide. L’idéologie hamitique. Paris: Éditions Belin.
- Diner, Dan (1988): Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz. Frankfurt/M.
- Dumas, Hélène (2000): Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994–2006), Paris: La Découverte 2000.
- Dumas, Hélène (2014a): Génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda. Paris: Éditions Seuil.
- Dumas, Hélène (2014b): Enfants victimes, enfants tueurs. Expériences enfantines (Rwanda, 1994), in: Vingtième siècle 122, Nr. 2, S. 75–86.
- Gourevitch, Philip (2002): Nous avons le plaisir de vous informer que, demain, nous serons tués avec nos familles. Chroniques rwandaises. Paris: folio documents.
- Hatzfeld, Jean (2000): Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais. Paris: Editions du Seuil.
- Hatzfeld, Jean (2003): Une saison de machettes. Paris: Points.
- Habonimana, Charles (2019): Moi, le dernier Tutsi. Paris: Plon.
- Human Rights Watch (Hg.) (1995): Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda. Paris: Karthala.
- Lammers, Philipp/Twellmann, Marcus (2021): L’autosociobiographie, une forme itinérante. URL: https://doi.org/10.4000/contextes.10515.
- Mugesera, Antoine (2014): Les conditions de vie des Tutsi au Rwanda de 1959 à 1990. Persécutions et massacres antérieurs au génocide de 1990 à 1994. Kigali: Édition Dialogue.
- Mujawayo, Esther/Belhaddad, Saoud (2011) Survivantes. Paris: Métis.
- Mukasonga, Scholastique (2006): Inyenzi ou les Cafards. Paris: Gallimard.
- Mukasonga, Scholastique (2008): La femme aux pieds nus.Paris: Gallimard.
- Mukasonga, Scholastique (2010): L’Iguifou. Paris: Gallimard.
- Peiter, Anne D. (2007): „Erlebte Vorstellungen“ versus „den Vorstellungen abgezogene Begriffe“. Überlegungen zum Shoah-Kitsch, in: Nach-Bilder des Holocaust. Hg. von Inge Stephan und Alexandra Tacke. Köln: Böhlau Verlag, S. 66–76.
- Peiter, Anne D. (2019): Träume der Gewalt. Studien der Unverhältnismäßigkeit zu Texten, Filmen und Fotografien. Nationalsozialismus – Kolonialismus – Kalter Krieg. Bielefeld: transcript.
- Peiter, Anne D. (2023a): Invektiven im Genozid. Zu Zeugnissen von überlebenden Tutsi, in: Invective discourse, hrsg. von Heidrun D. Kämper, Simon Meier-Vieracker, Ingo H. Warnke, Berlin: De Gruyter, S. 149-175.
- Peiter, Anne D. (2023b): Genozide und die Frage nach dem „Warum?“ Komparatistiche Überlegungen zum Konzept der „extremen Grundlosigkeit“ in autobiographischen Zeugnissen von Überlebenden der Shoah und des Tutsizids, in: dive-in, 3 (1).
- Peiter, Anne D.: Der Genozid an den Tutsi Ruandas. Von den kolonialen Ursprüngen bis in die Gegenwart. Marburg 2024.
- Peiter, Anne D. [in Vorbereitung a]: „Etc. etc. etc.“ Zum Zwischenspiel von „großer“ Geschichte und „kleiner“ Lebensgeschichte bei Johann Peter Hebel und Annie Ernaux. [Der Artikel erscheint voraussichtlich 2025 in einem Sammelband zur Soziobiographie und Bourdieu].
- Peiter, Anne D. [in Vorbereitung b]: Hunger und Durst im ‚Genozid der Nähe‘. Zu Zeugnissen überlebender Tutsi. [Der Artikel wird 2024 in einem Sammelband über Hungerpolitiken erscheinen, hg. von Olga Sturkin et al.].
- Peiter, Anne D. [in Vorbereitung c]: „Tausche abgebüsste Haft gegen komplette Entschuldung“. Zur Wahrnehmung von Gefängnis in Interviews von Mördern des Tutsizids in Ruanda am Beispiel von Jean Hatzfelds „Une saison de machettes“. [Der Artikel erscheint 2024 in einem Sammelband über ‚Gesellschaft und Gefängnis‘].
- Peiter, Anne D. [in Vorbereitung d]: Verschwörungsmythen, ethnische Ursprungslegenden und der Tutsizid. Überlegungen zur deutschen Kolonialliteratur und ihren Konsequenzen für die Geschichte Ruandas. [Der Aufsatz erscheint 2024 in einem Band der Zeitschrift Limbus über Verschwörungsmythen, hg. von Andreas Dorrer].
- Peiter, Anne D. [in Vorbereitung e]: „Wir standen vor vollendeten Tatsachen, die wir vollenden mussten, wenn ich mal so sagen darf.“ Vom Verschwinden des argumentativen Austauschs während der Shoah und des Tutsizids in Ruanda. [Der Aufsatz erscheint 2024 in einem Sammelband über Argumentationsstrategie: „Klären und Streiten“].
- Prudhomme, Florence (2019): Cahiers de mémoire, Kigali 2019. Paris: Classiques Garnier.
- Prunier, Gérard (1995): The Rwanda Crisis. History of a Genocide 1959–1994. London: Hurst & Co.
- Rohrbacher, Peter (2002): Die Geschichte des Hamiten-Mythos. Wien: Afro-Pub (Beiträge zur Afrikanistik 71).
- Sauvain-Dugerdil, Claudine (2021): Se construire dans une société à la dérive. La force de vivre d'une Rwandaise. Vervey.
- Werle, Otmar/Weichert, Karl-Heinz (1987): Ruanda. Ein landeskundliches Porträt. Koblenz: Landesbildstelle Rheinland-Pfalz/Görres-Verlag.
Anmerkungen
Top of page„Wir hatten größere Angst vor dem Zorn der Autoritäten als vor dem Blut, das wir fließen ließen.“ (Pancrace Hakizamungili in Hatzfeld 2003: 80, [Übersetzung A.P.]).
BackVgl. Peiter [in Vorbereitung]: Gewalt an Tieren. Gewalt an Menschen. Überlegungen zur Genozid-Prävention am Beispiel der Tier-Mensch-Beziehungen im Tutsizid in Ruanda. Der Artikel erscheint 2025 in einem Band über „Tiere als kulturelles Erbe“.
BackHatzfeld war zwar anfänglich kein Ruanda-Experte. Doch da er stets von Neuem nach Ruanda zurückkehrte, um in der immer gleichen Ortschaft die immer gleichen Menschen zu treffen, gewann er ein Verständnis für Zusammenhänge, das in mindestens einer Hinsicht als vorbildlich gelten darf: Er exotisierte die Katastrophe, die sich in Ruanda abgespielt hatte, nicht, sondern war bestrebt, einen Austausch zu stiften zu dem, was in Europa über die Shoah ins allgemeine Bewusstsein gedrungen war.
BackDieser Umstand wird schon – doch unter Verwendung einer unverkennbar kolonialideologischen Rhetorik – schon in dem Band von Werle/Weichert (1987) betont.
BackZum theoretischen Hintergrund für diesen Begriff vgl. Peiter [in Vorbereitung a]: „Etc. etc. etc.“ Zum Zwischenspiel von „großer“ Geschichte und „kleiner“ Lebensgeschichte bei Johann Peter Hebel und Annie Ernaux.
BackWas die Frage nach dem Geschlecht der Täter anbelangt, so ist anzumerken, dass Frauen vor 1994 sehr viel seltener in Erscheinung traten als später. 1994 kam es zu einer grundlegenden Veränderung. Es ist demnach wichtig, immer von Täter:innen zu sprechen. Hatzfeld hat jedoch im Gefängnis von Rilima ausschließlich Männer interviewt. Immer wenn von seinem Buch die Rede ist, muss man darum auf Täter - im männlichen Sinne verstanden - verweisen.
BackIn literaturgeschichtlicher Hinsicht hält Bourdieu schon für das 19. Jahrhundert fest: „L’évolution du champ de production culturelle vers une plus grande autonomie s’accompagne [...] d’un mouvement vers une plus grande réflexivité, qui conduit chacun des ‘genres’ à une sorte de retournement critique sur soi, sur son propre principe, ses propres présupposés: et il est de plus en plus fréquent que l’œuvre d’art, vanitas qui se dénonce comme telle, inclue une sorte de dérision d’elle-même“ (Bourdieu 1996: 398). („Die Entwicklung des Felds der kulturellen Produktion hin zu einer größeren Autonomie wird [...] begleitet durch eine Bewegung hin zu größerer Reflexivität, die jedes ‘Genre’ zu einer Art kritischen Wendung hin zu sich selbst, zu seinen eigenen Prinzipien, zu seinen eigenen Voraussetzungen führt: Es wird immer häufiger, dass das Kunstwerk, vanitas, das sich selbst als solche anprangert, eine Art von Lächerlichmachung seiner selbst enthält.“ [Übersetzung A.P.])
BackVgl. Gourevitch 2002. – Auch Lukas Bärfuss thematisiert in seinem Roman (Hundert Tage, 2008) über den Genozid das Problem einer ‚Entwicklungshilfe‘, die die Gefahren des Radios nicht kommen sah.
BackDazu Genaueres in Peiter [in Vorbereitung d]: Verschwörungsmythen, ethnische Ursprungslegenden und der Tutsizid. Überlegungen zur deutschen Kolonialliteratur und ihren Konsequenzen für die Geschichte Ruandas.
BackDie folgenden Bücher sind in diesem Kontext lesenswert: Mukasonga 2008; Mukasonga 2010; Mukasonga 2006.
BackVgl. Mukasonga 2006: 14. Es heißt dort: „Les premiers pogromes contre les Tutsi éclatèrent à la Toussaint 1959. L’engranage du génocide s’était mis en marche. Il ne s’arrêterait plus. Jusqu’à la solution finale, il ne s’arrêterait plus.“ („Die ersten Pogrome gegen die Tutsi brachen zu Allerheiligen 1959 aus. Der Mechanismus des Genozids hatte sich in Gang gesetzt. Er würde nicht mehr aufhören. Bis zur Endlösung würde er nicht mehr aufhören.“ [Übersetzung A.P.])
BackDie Unablässigkeit der Arbeit kann außerdem auf den Druck zurückgeführt werden, den die ruandischen Militärs und die Hutu-Miliz auf die Zivilbevölkerung zwecks Vernichtung der Tutsi ausübten. Die Intentionalität der Vernichtung erklärt also nicht allein den Verzicht auf Ruhezeiten.
BackHier spielten zugleich auch der Bürgerkrieg und die Abschreckungsstrategie der Behörden eine Rolle: Es war diesen gelungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ein eventueller Sieg der ‚Rebellen‘ eine Vernichtung der Hutu-Gruppe oder zumindest ihre Unterwerfung herbeiführen würde.
BackVgl. Peiter [in Vorbereitung e]: „Wir standen vor vollendeten Tatsachen, die wir vollenden mussten, wenn ich mal so sagen darf.“ Vom Verschwinden des argumentativen Austauschs während der Shoah und des Tutsizids in Ruanda.
BackDieser Gedanke erscheint auch im Titel der folgenden Autobiographie eines Überlebenden, Charles Habonimana: Moi, le dernier Tutsi (2019).
BackGestorben wurde darüber hinaus an Hunger und Durst, weil die Kirchen in der Regel nichts hatten, was die Versorgung der Menschen hätte sicherstellen können. Dazu Genaueres in: Peiter [in Vorbereitung b]: „Hunger und Durst im ‚Genozid der Nähe‘. Zu Zeugnissen überlebender Tutsi“.
BackDies hat dann auch Einfluss auf das fehlende Schuldbewusstsein der Täter. Vgl. Peiter [in Vorbereitung c]: „Tausche abgebüßte Haft gegen komplette Entschuldung“. Zur Wahrnehmung von Gefängnis in Interviews von Mördern des Tutsizids in Ruanda am Beispiel von Jean Hatzfelds ‚Une saison de machettes‘“.
BackScholastique Mukasonga beschreibt eine solche Feier, die ihrem eigenen schulischen Erfolg gegolten habe (vgl. Mukasonga 2006: 75).
BackVgl. Prudhomme 2019, darin besonders: Béata Mazizane: Le chagrin n’est pas un pleur incessant, S. 51-72.
Back