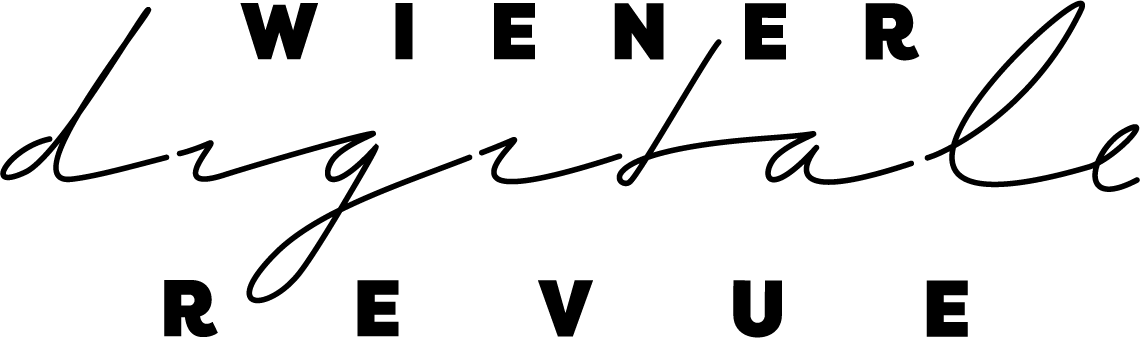
Zeitschrift für Germanistik und Gegenwart
Daniel Milkovits
(Nach-)Krieg und (Un-)Frieden
Zu Fritz Kortners Volksstück DonauwellenLizenz:
For this publication, a Creative Commons Attribution 4.0 International
license has been granted by the author(s), who retain full
copyright.
Link
Wiener Digitale Revue 5 (2024)
www.univie.ac.at/wdrAbstract
Top of pageSchlagwörter
Top of pageSchlagwörter:
Volltext
Top of pageJüngere Debatten haben ein nicht gerade schmeichelhaftes Licht auf die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur und besonders auf die dominante Gruppe 47 geworfen.1 Der deutsche Germanist Klaus Briegleb (2003) etwa hat der Dichtergemeinschaft in seiner provokanten Streitschrift Mißachtung und Tabu angelastet, mit ihrer teils vorbelasteten Mitgliederschaft nicht nur einen latenten Antisemitismus zu perpetuieren, sondern auch in einem stillschweigenden Verbund mit der kollektiven Verdrängung und unzureichenden Aufarbeitung der begangenen Kriegsverbrechen zu stehen.
Diesen Vorwurf muss sich mitunter auch die österreichische Literatur gefallen lassen, denn erst schleichend erarbeitete sie sich ihren Status als korrigierende Instanz mit einem expliziten Gegendiskurs zu jener Staatsdoktrin, die sich selbst als erstes Opfer Hitlerdeutschlands gerierte und als unrühmlicher ‚Opfermythos‘ in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Schließlich legt nicht nur die Liste der Staatspreisträger:innen der ersten Nachkriegsjahre eine Kontinuität zwischen nazistischem und ‚postnazistischem‘ Literaturbetrieb nahe (vgl. Müller 1990, Amann 1992, Innerhofer 2016); es spricht auch für sich, dass der zu jener Zeit hochdekorierte Schriftsteller Alexander Lernet-Holenia (1995: 149) davon sprach, man brauche „nur dort fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben“. Erst etwas später hat die unterschwellig neorealistische Ausrichtung der Gruppe 47 von österreichischer Seite Kritik laut werden lassen – etwa durch Peter Handke und die Wiener Gruppe – und Alternativkonzepte provoziert, die Sprache und Literatur vom Druck der Referenz entlasteten (vgl. Sonnleitner 2016). Noch länger dauerte es, bis der Nationalsozialismus, die Shoa und das individuelle wie kollektive Problem der Verdrängung zu einem derart dominanten und ‚salonfähigen‘ Thema des (aus der heutigen Retrospektive als solcher erachteten) österreichischen Literaturkanons wurden – so etwa, wenn in Thomas Bernhards Skandalstück Heldenplatz (1988) eine aggressive Schimpfsuada voll provokanter Pauschalisierungen ausgebreitet wird (vgl. Pfabigan 2012, Huber 2012) oder wenn Elfriede Jelinek im Roman Die Kinder der Toten (1995) mit zombieartiger Brutalität vorführt, dass über die Toten des Weltkriegs ‚kein Gras gewachsen‘ sei (vgl. Strigl 1997, Kastberger 2003). Ein bis heute ungemein produktives Sujet der österreichischen Gegenwartsliteratur ist all das ohnehin, wie mit Raphaela Edelbauers Das flüssige Land (2016) und Eva Menasses Dunkelblum (2021) zwei sehr rezente Texte belegen, die in der Tradition des von Jelinek prominent mitgeprägten Topos einer ‚kontaminierten Landschaft‘ stehen (Lückl 2023).
Die literarische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit begann freilich schon weit früher, doch sie hatte einen schweren Stand: So legte Hans Lebert mit seinem Roman Die Wolfshaut (1960) den Finger zwar tief in die Wunden der Nachkriegsgesellschaft, doch davon, dass er „einschlug wie eine Bombe“ (Ganzer 1997: 146), kann wahrlich keine Rede sein. Mittlerweile ist die besagte Auseinandersetzung in der österreichischen Literatur, mit Günther Stocker (2019: 63) gesprochen, geradezu „notorisch“, und sie ist es leider auch, weil durch das politische Tagesgeschehen beinahe regelmäßig ein mahnendes Erinnern geboten ist. Und das mittlerweile auch über die Staatsgrenzen hinaus – aufgrund von Entwicklungen, für die die Alpenrepublik spätestens seit dem Phänomen Jörg Haider und dem bis heute grassierenden, von Falter-Herausgeber Armin Thurnher so bezeichneten „Feschismus“ (zit. n. Weinzierl 2002) als Vorreiterin gelten kann. Der gesellschaftliche Status, den das Thema in der österreichischen Literatur heute hat, musste aber erst erstritten werden – dass die Wolfshaut 1960 zwar positiv registriert wurde, danach aber für Jahrzehnte in den Hintergrund trat, ist dafür ein Beleg.
Ein weiterer Beleg ist ein anfangs unterschätztes Genre, das österreichische Debatten rund um die nationalsozialistische Vergangenheit – oder häufig auch das Problem, dass es eben erst gar keine Debatte gab – eindrucksvoll auf die Bühne brachte: das Volksstück. Dieser Gattungsbegriff ist aufgrund seiner diachronen Instabilität problematisch und wird häufig als summarischer umbrella term für sämtliche Spielarten populären Theaters, etwa seit Nestroy, verwendet, was aus mehreren Gründen unzulässig ist (vgl. Milkovits 2024). Wenn hier und im Folgenden vom Volksstück die Rede ist, so ist damit aber ebenfalls ein Etikett gewählt, das im Peritext des betreffenden und der umliegenden Texte überhaupt nicht aufscheint. Das dürfte damit zu tun haben, dass die Rede vom ‚Volk‘ und damit auch jene vom ‚Volksstück‘ durch den Nationalsozialismus kompromittiert worden war, sodass die Autoren – man muss hier leider nicht gendern – wohl zu vermeiden suchten, mit dieser Tradition und ihrer teils völkischen Ausprägung assoziiert zu werden. Erst in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts setzte durch die Rehabilitierung Ödön von Horváths und Marieluise Fleißers eine schrittweise Korrektur dieser in Misskredit geratenen Reputation ein, was außerdem eine ganze Reihe sog. ‚Neuer Volksstücke‘ zur Folge hatte, etwa aus der Feder Peter Turrinis und Felix Mitterers (vgl. Aust/Haida/Hein 1989: 312). Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass sich bereits einige in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten entstandene Stücke für diese Gattung reklamieren lassen, die sich ihrem Namen gemäß hervorragend „als Vehikel für eine kritische Darstellung gesellschaftlicher Zustände“ (Bobinac 2000: 47) eignet und den Verfassern dabei half, den Nationalsozialismus ebenso kritisch zu hinterfragen wie den sogenannten Postfaschismus. Diese kritische Hinterfragung auf der Bühne war allerdings lediglich eine temporäre und wurde danach bis zum besagten Volksstück-Revival ein gutes Jahrzehnt nicht weitergeführt. Dies liegt am ehesten daran, dass theatrale Vergangenheitsbewältigung wie diese mit dem Nation Building des neuerstandenen Österreichs kollidierte, sodass man „negative Auswirkungen auf den Stabilisierungsprozess der Nachkriegsgesellschaft befürchtet[e]“ (ebd.: 49).
Einer der infrage kommenden Autoren ist Fritz Kortner, der eigentlich Nathan Kohn hieß. Kortner wurde 1892 in Wien als Sohn eines jüdischen Juweliers geboren und startete mit der Hilfe seines Lehrers eine Schauspielkarriere in Deutschland, zunächst in Mannheim und anschließend in Berlin, aber auch in Wien. In der Weimarer Republik konnte sich Kortner hervorragend etablieren, bis ihn der aufkommende Nationalsozialismus 1933 ins Exil zwang – bis 1937 in London und weitere zehn Jahre, bis 1947, in den USA (vgl. Völker 2009). Das Stück Donauwellen, das noch in den USA entstand, wurde nach Kortners Rückkehr am 15. Feber 1949 bei den Münchner Kammerspielen uraufgeführt, wo es bis Ende Mai desselben Jahres 29 Mal wiederholt wurde. Die Kritik lobte nicht nur das realistische Bühnenbild, sondern auch die gelungene Regie; beanstandet wurden hingegen die aus Sicht der Kritiken allzu übertriebenen kabarettistischen Züge des Stücks, die den Münchner Rezensenten wohl auch aufgrund ihrer Anknüpfung an genuin wienerische Theatertraditionen – auf die später noch eingegangen wird – gegen den Strich gingen. Wiederaufführungen gab es erst 1980 in Düsseldorf; in Wien, dem Schauplatz des Stücks, kam es gar erst 1987 zu einer ersten Aufführung (vgl. Völker 1993: 210). Für verfängliche Themen wie dieses gab es im Wien der unmittelbaren Nachkriegszeit offenbar – im doppelten Sinne – kaum eine Bühne.
Ein erstes Treatment Kortners zu einem „Wiener Volksstück“, das später in die Donauwellen münden sollte, findet sich bereits im Mai 1945 – also unmittelbar zu Kriegsende – dokumentiert und trägt den Titel Herren- und Damen-Frisiersalon Wien I. Eine im Herbst 1946 an sich bereits fertiggestellte Fassung des Stücks hätte noch den Titel Ein Traum, kein Leben tragen sollen und bezog sich offensichtlich auf die allegorische Traumszene im dritten Akt, in der Personifikationen der Besatzungsmächte auftreten. Es handelt sich dabei aber auch um eine offenkundige Anspielung auf Franz Grillparzers „dramatisches Märchen“ Der Traum ein Leben (1834) bzw. wiederum auf dessen Prätext La vida es sueño (dt. Das Leben ein Traum, 1635) des spanischen Klassikers Pedro Calderón de la Barca (vgl. Schütze 1994: 92).
Die endgültige Fassung des dreiaktigen Stücks, auf die sich auch dieser Beitrag bezieht, spielt schließlich im Wien des Frühlings 1945 und damit in den Tagen der Befreiung durch die alliierten Truppen sowie in der Zeit danach. Schauplatz ist der Friseursalon der Hauptfigur Alois Duffeck in der Jasomirgottesgasse 11 im ersten Wiener Gemeindebezirk – tatsächlich existiert dort nur die Jasomirgottstraße, die vom Portal des Stephansdoms in Richtung Petersplatz führt. Duffeck wird von Beginn an als ein opportunistischer „Gewinner aller Systeme“ (Krohn 2015: 79), als ein „Künstler der Anpassung“ (Bobinac 2000: 53) eingeführt, der, um die ökonomische Sekurität seines Geschäfts und seiner Person möglichst lange zu wahren, das Fähnchen stets nach dem Wind hängt, der in der Wienerstadt gerade weht: So hat er es sich auch mit den Nazis ganz gut gerichtet; vom Rüstungsindustriellen bis zum Polizeiinspektor geht in seinem Salon jedermann ein und aus, um sich frisieren oder rasieren zu lassen. Der dramatische Konflikt selbst ist aber weitaus drastischer: Den besagten Friseursalon hat Duffeck dem jüdischen Vorbesitzer Spitz, der im Zuge der Shoa mittlerweile zu Tode gekommen ist, gegen Beginn des Krieges und der damit einhergehenden Zwangsenteignungen jüdischer Geschäfte zu einem Spottpreis abgekauft; seine solide kleinbürgerliche Existenz als selbständiger Friseur ‚verdankt‘ sich einem Arisierungsgewinn und insofern einem unbestreitbaren nationalsozialistischen Verbrechen. In Duffecks Salon kreuzen sich sämtliche Handlungsstränge: Die Kund:innen berichten von den soeben mitbekommenen Geschehnissen auf den Wiener Straßen und machen einen Schauplatzwechsel auf diesem Wege weitgehend obsolet. Die „fehlende epische Breite“ (ebd.) des Stücks, das zeitlich auf das Ende des Weltkriegs beschränkt ist, wird durch diesen belebten Ort ausreichend ausgeglichen, indem auch das mitläuferische Verhalten des Friseurs über Erinnerungen der ihn umgebenden Figuren, also gleichsam durch einen retrospektiven Botenbericht, auf die Bühne gebracht wird.
In seiner Studie zur Komödie in der deutschsprachigen Exilliteratur hat Bernhard Spies (1997: 27f.) darauf aufmerksam gemacht, dass die Kund:innen des Salons allesamt aus vergleichbaren Motiven heraus handeln, und zwar aus ökonomischen: Sie alle bangen ob der herannahenden russischen Truppen um den Profit, den ihnen die einst neue Ordnung des nationalsozialistischen Regimes eingebracht hat. Ein Großbonze aus der Rüstungsindustrie etwa fürchtet sich wie seine Buhlschaft – die sich nach der Befreiung sogleich einen sowjetischen Soldaten anlacht –, das Kriegsende könnte ihn um seine lukrativen Aufträge bringen, während der Inspektor und der Polizeileutnant ihren Status als vom Regime und von der obrigkeitshörigen Masse respektierte Exekutivorgane gefährdet sehen. Gemein ist ihnen allen, dass sie nicht nur der Restitution ihres Eigentums mit Bange entgegensehen, sondern auch zu erwarten haben, von den Alliierten als ehemalige Handlanger der Nationalsozialisten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Entgegen der in den Geschichtsbüchern vermittelten Narration vom sehnsüchtig erwarteten Kriegsende verkörpern Duffecks Kund:innen jene Regimeprofiteur:innen, die der Befreiung nicht gerade mit Freude entgegensehen.
Eine deutlich sympathischere, weil gänzlich anders gezeichnete Figur ist demgegenüber Duffecks Friseurgehilfe Franz, der die Doppelmoral seiner Kund:innen ebenso durchschaut wie jene seines Chefs – und dabei noch dazu ganz und gar nicht auf den Mund gefallen ist. So weigert er sich beispielsweise am Beginn des Stücks, den Höflichkeitsallüren gegenüber dem übernächtig-verkatert im Stuhl dösenden Rüstungsindustriellen und seiner Frau, der berechnenden Baroness, zu entsprechen. Duffeck selbst weist ihn sogleich in die Schranken:
DUFFECK verweisend. Wenn’S nur die Rechnung nicht ohne Wirt machen, Franz! Und die Russen werden doch noch rausg’schmissen, dann hat sich’s damit aufgehört eine Baroness ein Pupperl heißen und einen Schwerindustriellen beuteln. (Kortner 1981: 10f.)
Dass der Friseur seinem Angestellten indirekt nahelegt, lieber „die Rechnung mit dem Wirten“ zu machen, ist bezeichnend: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing – so ließe sich sein Credo, dem er unter nationalsozialistischer Herrschaft gut Folge leisten konnte, pointiert zusammenfassen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Einmarsch der befreienden Truppen für Duffeck etwas Bedrohliches an sich hat: Er hofft darauf, dass sich die Situation noch einmal „dreht“ (ebd.: 10) – schließlich könnten die massiven Zerstörungen am Franz-Josefs-Kai, wie er sich einredet, „ja auch ein Gegenangriff von den Deutschen sein“ (ebd.: 11), die für ihre „Strategie“ berüchtigt seien (ebd.: 10).
Der sympathische Zug des Gehilfen Franz besteht eben darin, dass er an dieser kriegseuphorischen Realitätsverweigerung gegenüber der nahenden Befreiung ganz und gar nicht partizipiert. Sein trocken-zynischer Humor entlarvt vielmehr das Handeln der agierenden Figuren und gibt diese der Lächerlichkeit preis. Damit steht Franz gewissermaßen in der Wiener Theatertradition der Hanswurstiade, in der die in der Nebenhandlung auftretende Dienerfigur ebenfalls dazu diente, den hochtrabenden Diskurs der Haupthandlung ironisch zu vereiteln (vgl. Sonnleitner 1996, Müller-Kampel 2003). Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Als sich der Polizeileutnant Pachtel von Franz rasieren lässt, ist dies für den Großindustriellen Schorff ein Grund zum Zorn: Draußen gehe „alles drunter und drüber“; da könne ein Polizist doch nicht seelenruhig im Friseursalon sitzen und sich rasieren lassen. Darauf hat Franz sogleich eine polemische Erklärung für Pachtels dringlichen Salonbesuch parat: „Das Schnurrbärtchen mußte schnellstens weg, das kleine feine“, scherzt er, wobei er mit den Fingern laut Regieanweisung „ein Hitlerbärtchen“ andeutet. Als sich Pachtel dagegen zu wehren versucht, es handle sich ja nur um „ein englisches Barterl“ und „[e]in paar Millimeter kürzer oder länger, spiel[e] ja keine Rolle“, setzt Franz nach: „Jetzt, wo er weg ist!“ (Kortner 1981: 16).
Überhaupt ist die ideologische Prostitution der Exekutive im Stück ein zentrales Thema. Dazu gehört nicht nur die besagte frech kommentierte Rasur des Hitlerbärtchens für den Polizeileutnant Pachtel, sondern auch der beinahe schizophrene Auftritt eines uniformierten Inspektors, der die Ereignisse anscheinend weniger als Befreiung empfindet, als es seine Dienstauffassung geböte:
INSPEKTOR in Uniform, tritt ein. Also aus ist’s! Wir haben die Leopoldstadt räumen müssen ... beziehungsweise die Deutschen ... und somit sind unsere Truppen geschlagen ... beziehungsweise der Gegner ... und als Feind sind wir überall auf der Flucht! Er nimmt das Hakenkreuz ab. Der Erbfeind ... das heißt die Russen ... beziehungsweise unsere Freunde ... rücken vor ... das heißt, die gegnerische Armee beginnt soeben als Freund und Befreier den Einzug. Damit ist ganz Wien in unseren Händen. Für uns ist der Krieg aus! Steckt das Hakenkreuz in seine Tasche. (Ebd.: 20)
Erneut ist es der Gehilfe Franz, der die Prostitution identifiziert, indem er angesichts des entfernten Hakenkreuzes bemerkt: „Ich kann mich noch genau erinnern, wie Sie’s aus der Tasche gezogen und angsteckt haben.“ Den Inspektor selbst bringt diese Entlarvung kaum aus der Ruhe; er antwortet mit der hohlen Phrase: „Die Polizei muß immer in Bereitschaft sein“ (ebd.), sodass er Franz’ unterschwelligen Vorwurf indirekt nicht Lügen, sondern Wahrheit straft. Dieser Opportunismus ist der bittere Beigeschmack des Stücktitels, der auf den ersten Blick einen lokalpatriotischen Gemeinplatz des Österreichischen, den Donaustrom, bedient, der sich aber zugleich als Sinnbild einer Gesellschaft herausstellt, die moralisch mit dem Strom schwimmt, wenn etwa der Inspektor weiter fabuliert:
INSPEKTOR Meine Pflicht! Sehen Sie, ich mach’ seit 30 Jahren meinen Dienst, da hab’ ich viel gesehen, viel Wasser ist durch die Donau geflossen, viele Richtungen haben wir da mitgemacht, und jeder gegenüber waren wir loyal, darf ich wohl sagen, und haben sie überdauert. [...] Ich hab’ schon unterm alten Kaiser Dienst gemacht. [...] Und auch später beim Sozi Renner, bei Seiner Ehrwürden, dem Herrn Bundespräsident Seipel, beim Schober, bei unserem lieben Dollfuss und dann gar beim Führer selber. (Ebd.: 20f.)
Ideologische Flexibilität wäre wohl das euphemistischste Etikett für diese Geisteshaltung, die von der Sozialdemokratie eines Karl Renner über den Christkonservativismus eines Ignaz Seipel und den Polizeipräsidenten Schober bis hin zum Austrofaschisten Engelbert Dollfuß und zu Adolf Hitler nirgendwo ein Problem gehabt zu haben scheint, sich mit dem herrschenden System zu arrangieren. Wenn der Inspektor im zweiten Akt erneut gemeinsam mit Polizeileutnant Pachtel auftritt, wobei sie sich über das soeben arrangierte Spalier und die dafür zu erwartenden Kalorienrationen unterhalten (ebd.: 48/49), ist wiederum klar, dass ihre Anbiederung an den politischen Status quo auch mit den Besatzungsmächten kein Ende genommen hat. Der Friseur Alois Duffeck ist insofern zwar das dramatisch exponierteste „Stehaufmännchen des Opportunismus“, aber beileibe nicht das einzige – die Donauwellen könnte man völlig zurecht als „Wendehals-Lustspiel“ (Schütze 1994: 92) bezeichnen.
Ganz im Gegensatz zum klassischen Komödientypus mit seinen moralisch wie auch immer defizitären Figuren, die aufgrund dieser Defizite gesellschaftlich sanktioniert oder vom Kollektiv ausgeschlossen wurden – man denke an die ‚Komödienformel‘ von „Kollektiv und Störenfried“ (Klotz 2007: 23–25) –, ist die Quelle des Komischen in Kortners Stück ein zugleich überaus tragisches Massenphänomen:
Kortner kritisiert den Opportunismus nicht als ‚abweichendes Verhalten‘, im Gegenteil: Er inszeniert die überkommene Gleichsetzung von Erfolg des komödientragenden Subjekts und allgemeinem Recht, erkennt also den Opportunismus seiner Dramenfiguren als geltende Norm sozialen Verhaltens an, und zwar deshalb, weil er in den Komödienfiguren das allgemein Geltende insgesamt attackieren will. (Spies 1997: 30)
Im Zusammenhang mit Debatten rund um Krieg und Nachkrieg hat sich der vom deutsch-israelischen Historiker Dan Diner (1988) geprägte Begriff des „Zivilisationsbruchs“ etabliert und durchgesetzt. Schon weit zuvor hatte Fritz Bauer (2023 [1965]: 1396), der als Generalstaatsanwalt maßgeblich in die Auschwitz- und außerdem in die berüchtigten Eichmann-Prozesse involviert gewesen war, das bis heute gültige Bild geprägt, man könne an den besagten Prozessen ersehen, „wie nahe wir noch dem Affenstadium sind und wie dünn die Haut der Zivilisation war und ist“. Bekanntlich war es der Eichmann-Prozess auch, der zu Hannah Arendts nachgerade kultgewordener Schrift über die Banalität des Bösen (Arendt 2022 [1963]) geführt hat, die heute – zurecht – in kaum einer Untersuchung zum Nationalsozialismus und seinen gesellschaftlichen Voraussetzungen fehlt. Für den spezifisch österreichischen und besonders für den Wiener Kontext müsste darüber hinaus die jüngst neu aufgelegte (Hamann/Sachslehner/Rathkolb 2022) Studie Hitlers Wien der Historikerin Brigitte Hamann (1996) herangezogen werden, die den Antisemitismus im Wien der Zwischenkriegszeit als hausgemachten Beitrag zum Holocaust der Nationalsozialisten beschreibt. Keiner dieser Ansätze lässt sich für eine Beschäftigung mit Kortners Donauwellen gewinnbringend verwenden, denn die Genese des NS-Regimes wird in der Komödie weder thematisiert noch explizit problematisiert. Worum es vielmehr geht, ist das Problem persistenter Denkmuster, die sich mit einer militärischen Zäsur ganz offensichtlich nicht beseitigen lassen.
Ein solches Denkmuster ist etwa die Zugehörigkeit zum nationalsozialistischen Deutschland, die im Stück allerdings immer wieder Verwirrung stiftet. Im Gespräch mit dem Großindustriellen Schorff etwa ist sich Duffeck nicht mehr sicher, ob nun die befreienden Truppen die „unseren“ sind oder doch die deutschen (Kortner 1981: 14). Von Täter-Opfer-Umkehr und Victim Blaming würde man heute außerdem sprechen, wenn Duffeck über die Novemberpogrome, die sogenannte Reichskristallnacht, nichts anderes zu sagen weiß, als dass er, der er den Laden des jüdischen Vorbesitzers übernommen hatte, dieses erschlichene Vermögen noch sanieren musste: „Und dann wurden die Scheiben zerteppert und die Riesenspiegel, und ich hab’ dann alles frisch machen lassen müssen“ (ebd.: 21). Seine Unsicherheit hinsichtlich der besagten Zugehörigkeit und der Frage, für oder gegen wen er denn nun sein solle, fasst er gar als Bürde auf:
DUFFECK [...] Ich höre, die sind für die Juden, die Russen, hör’ ich ... kein Haar darf man ihnen gekrümmt haben. Ihr wart’s gegen sie. Gegen sie, für sie, gegen sie, für sie, wie soll da ein Mensch mitkommen. Die einen zwingen einen, sie zu hassen, die andern zwingen einen zur Liebe ...! Nichts als Zwang – bei beiden! G’hupft wie gesprungen, einer wie der andere! Keine Freiheit! Wie soll der Mensch ohne Freiheit leben? (Ebd.: 31f.)
Gerade der letzte Satz dieser Klage ist ein Hohn aus dem Mund eines Kleinbürgers, den die Arisierung eines jüdischen Geschäfts unbeschadet durch die Kriegsjahre gebracht hat – das Geschäft eines Juden zumal, der durch die Shoa zunächst tatsächlich die besagte Freiheit und letztlich sogar das Leben lassen musste. Eine Aussicht auf eine bessere Zukunft gibt es dabei wohl kaum, beklagt sich doch Duffeck gegen Ende des Stücks: „Das hab’ ich nötig gehabt, einen Anschluß! Was ich mitmach’, wegen dem bissel Mitmachen!“ – dabei darf er sein Geschäft doch behalten und biedert sich fortwährend an die amerikanischen Besatzer an. Was sich durchsetzt, ist der Ratschlag der Baroness, dass man „mit einem bissel Entgegenkommen und savoir vivre [...] die schlimmsten Krisen“ überstehe (ebd.: 85). Umso illusionsloser sind einige der letzten Zeilen des Bühnentexts, in denen der amerikanische Major angibt, er und seine Leute seien „ausschließlich an einer möglichst ungestörten Aufrechterhaltung aller noch vorhandenen Betriebe interessiert“. Als der Soldat Russel entgegnet, er wolle sich wohl auch um die „Wiedergutmachung“ kümmern, entgegnet der Major: „Diese Wiedergutmachung wird einer späteren, österreichischen Regierung überlassen“, worauf Russel antwortet: „... die wiederum ihrerseits an der ungestörten Aufrechterhaltung der Betriebe interessiert sein wird“ (ebd.: 91). Mit einem Blick in die Geschichtsbücher ist diese Aussicht geradezu prophetisch.
Kortners Donauwellen sind kein radikaler Abgesang auf die Schrecken des NS-Regimes oder auf die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Möglichkeit. Sie sind vielmehr eine tragische Komödie über die Artifizialität historischer Zäsuren, über die Verlogenheit des beginnenden Postfaschismus und über die Kontinuität jener Denkmuster, die man im Opfermythos noch lange Zeit von sich weisen wollte:
Kortner fürchtet nicht mehr die politische Gewalt des Nationalsozialismus, er fürchtet die soziale und moralische Grundlage dieser Gewalt, die Masse der Opportunisten, ohne die jene Macht nichts vermocht hätte. In dieser Grundlage hat die üble Macht ihr Ende überlebt – das ist der thematische Grundeinfall seines komischen Spiels. (Spies 1997: 27)
Wenn eine Gesellschaft – und so stellt sie das Stück dar – mit einer radikalen „Umwertung der Werte“ (ebd.: 28) kein Problem mehr hat, sondern „auf allen politischen Wellen an der Donau mitzureiten“ (Krohn 2015: 80) bereit ist, seien sie auch noch so menschenverachtend, so ist dies der Weg in eine brandgefährliche ‚Ideologie der Ideologielosigkeit‘, die jederzeit in ein Extrem umschlagen kann, das so schnell nicht zu korrigieren ist. Auch das ist die Botschaft von Kortners Donauwellen und seinem opportunistischen Friseur Alois Duffeck. Und eine hochaktuelle noch dazu.
Ein etwas voraussetzungsreicherer Zusammenhang, der an dieser Stelle aus Platzgründen nicht mehr ausgebreitet werden kann, bestünde darin, das Stück mit anderen Wiener Produktionen zu vergleichen. Alois Duffeck ließe sich dabei just in der Mitte zwischen zwei Wiener Theatergestalten der Nachkriegszeit positionieren, die in der österreichischen Kulturgeschichte der Zweiten Republik einen festen Stellenwert haben: zwischen dem Fleischhauer Karl Bockerer aus der „tragischen Posse“ Der Bockerer (1946) von Ulrich Becher und Peter Preses und dem Herrn Karl, dem titelgebenden Feinkostmagazineur aus dem 1961 uraufgeführten Monodrama von Carl Merz und Helmut Qualtinger.2 Für den vorliegenden Beitrag muss es bei einem schlichten Hinweis bleiben, doch dass das Wiener Theater Spielraum (2015) Kortners Stück anlässlich seiner Aufführung als „eine Art Antithese zum ‚Bockerer‘“ bezeichnet hat, seine Hauptfigur außerdem als „typisch wienerische[n] Charakter“ und einen „andere[n] Herr[n] Karl“, mag die Sinnfälligkeit des Bezugs bereits andeuten.
Als die Donauwellen 1949 uraufgeführt wurden, nahm sie ein anonymer Kolumnist mit dem Pseudonym „Servus“ in den Salzburger Nachrichten zum vermeintlichen Beweis, dass die österreichischen „Mitmacher“ eine „quantité négligeable“ seien, eine Menge also, die klein genug sei, um sie zu vernachlässigen (Servus 1949: 5). Mit seiner Komödie, so der Verfasser, habe es Kortner zuwege gebracht, „gewissermaßen den Schlußstrich unter das tragikomische Kapitel der Entnazifizierung zu ziehen“ (ebd.). Diese Rezension ist ein idealtypisches Beispiel für die von Peter Roessler (1985: 37) beschriebene „Rezeptionsgewohnheit, die mit dem Volksstück a priori bereits Gemütlichkeit, Harmlosigkeit oder entleerte Unterhaltung assoziiert“.
Dass man Kortners Stück mit diesem leichtfertigen Urteil allzu Unrecht tut, dürften die vorliegenden Überlegungen zumindest angedeutet haben. Diese „scharfsinnige Komödie der Weiterwurstelmentalität“ (Völker 1993: 210) ließe sich vielmehr zum Anlass einiger Gedanken darüber nehmen, dass es auch dieser Tage keine ‚Stunde null‘ geben können wird, dass zwischen Krieg und Frieden immer auch Nachkrieg und Unfrieden liegt. Die unverschämten Wendehälse und Kriegsgewinnler vom Schlage Duffecks – jene Criminal Minds also, die eben nur auf der Bühne und auch dort nur in Fieberträumen belangt werden – haben jedenfalls überlebt, auch wenn sie heute wie damals meist mit mehr als nur mit Haarschnitten und Rasuren ihre Geschäfte machen.
Literaturverzeichnis
Top of page- Amann, Klaus (1992): Men for all Seasons. Österreichische Literaturpreisträger der fünfziger Jahre, in: ders.: Die Dichter und die Politik. Essays zur österreichischen Literatur nach 1918. Wien: Deuticke, S. 219–222.
- Arendt, Hannah (2022): Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen [i.e. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 1963]. Erw. Neuausg. Aus dem amerik. Engl. v. Brigitte Ganzkow. Hg. v. Thomas Meyer. Mit einem Nachw. v. Helmut König. München: Piper.
- Aust, Hugo/Haida, Peter/Hein, Jürgen (1989): Volksstück. Vom Hanswurstspiel zum sozialen Drama der Gegenwart. München: C. H. Beck.
- Bauer, Fritz (2023): Antinazistische Prozesse und politisches Bewußtsein. Dienen NS-Prozesse der politischen Aufklärung [1965]?, in: Lena Foljanty/David Johst (Hg.): Kleine Schriften (1921–1961). Bd. 2. Frankfurt a. M./New York: Campus (Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts 32/II), S. 1390–1405. DOI: 10.12907/978-3-593-43874-0.
- Bobinac, Marijan (1992): Der Bockerer und der Herr Karl. Das österreichische Volksstück in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten, in: Zagreber Germanistische Beiträge 1, S. 53–64.
- Bobinac, Marijan (2000): Überlebensstrategien. Zum österreichischen Volksstück der Nachkriegszeit: Ulrich Becher, Fritz Kortner und Arnolt Bronnen, in: Zagreber Germanistische Beiträge 9, S. 45–65.
- Briegleb, Klaus (2003): Mißachtung und Tabu. Eine Streitschrift zur Frage: „Wie antisemitisch war die Gruppe 47?“ Berlin/Wien: Philo.
- Diner, Dan (Hg.) (1988): Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz. Übers. aus dem Engl. u. Amerik. v. Susanne Hoppmann-Löwenthal. Frankfurt a. M.: Fischer (Fischer-Taschenbücher 4398).
- Ganzer, Silla (1997): Die Toten haben Hunger. Zu Hans Leberts Roman Die Wolfshaut, in: Cahiers d’Études Germaniques 32/1, S. 143–158.
- Hamann, Brigitte (1996): Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. München: Piper.
- Hamann, Brigitte/Sachslehner, Johannes/Rathkolb, Oliver (2022): Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. Der Klassiker komplett neu bearbeitet. Wien/Graz: Molden.
- Huber, Martin (2012): Was war der „Skandal“ an Heldenplatz? Zur Rekonstruktion einer österreichischen Erregung, in: Johann Georg Lughofer (Hg.): Thomas Bernhard. Gesellschaftliche und politische Bedeutung der Literatur. Wien/Köln/Weimar: Böhlau (Literatur und Leben 81), S. 129–136. DOI: 10.7767/boehlau.9783205790167.129.
- Innerhofer, Roland (2016): „In der Tat brauchen wir nur dort fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben“. Kontinuitäten in der österreichischen Literatur von der Ersten zur Zweiten Republik. In: Moritz Baßler/Hubert Roland/Jörg Schuster (Hg.): Poetologien deutschsprachiger Literatur 1930–1960. Kontinuitäten jenseits des Politischen. Berlin/Boston: De Gruyter (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte 146), S. 105–117. DOI: 10.1515/9783110418897-006.
- Kastberger, Klaus (2003): Österreichische Endspiele: Die Toten kehren zurück. Abgerufen von www.inst.at/trans/15Nr/05_16/kastberger15.htm, Zugriff am 28.12.2023.
- Klotz, Volker (2007): Bürgerliches Lachtheater. Komödie, Posse, Schwank, Operette. 4. Aufl. Heidelberg: Winter: 42007 (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte 239).
- Kortner, Fritz (1981): Donauwellen [1949], in: Matthias Brand (Hg.): Theaterstücke. Köln: Prometh-Verlag, S. 7–92.
- Krohn, Wiebke (2015): Donauwellen (Komödie von Fritz Kortner, 1949). In: Wolfgang Benz (Hg.): Handbuch des Antisemitismus. Bd. 7: Literatur, Film, Theater und Kunst. Berlin/München/Boston: De Gruyter, S. 79–80. DOI: 10.1515/9783110340884.
- Lernet-Holenia, Alexander (1995): Gruß des Dichters. Brief an den „Turm“ [1945], in: Petra Nachbaur/Sigurd Paul Scheichl (Hg.): Literatur über Literatur. Eine österreichische Anthologie. Innsbruck: Haymon, S. 149–150.
- Lückl, Julia (2023): Verscharrt. Verdrängt. Verschwiegen. Kontinuität und Wandel eines österreichischen Topos in Raphaela Edelbauers Das flüssige Land, Masterarbeit Universität Wien.
- Milkovits, Daniel (2024): „So schreiben Sie doch eine traurige Posse“. Posse und Lebensbild im Wien um 1850: Theoreme und Fallstudie. Wien: Praesens.
- Müller, Karl (1990): Zäsuren ohne Folgen. Das lange Leben der literarischen Antimoderne Österreichs seit den 30er Jahren. Salzburg: Otto Müller.
- Müller-Kampel, Beatrix (2003): Hanswurst, Bernardon, Kasperl. Spaßtheater im 18. Jahrhundert. Paderborn/München/Wien/Zürich: Schöningh.
- Pfabigan, Alfred (2012): Motive und Strategien der Österreichkritik des Thomas Bernhard, in: Johann Georg Lughofer (Hg.): Thomas Bernhard. Gesellschaftliche und politische Bedeutung der Literatur. Wien/Köln/Weimar: Böhlau (Literatur und Leben 81), S. 35–48. DOI: 10.7767/boehlau.9783205790167.35.
- Roessler, Peter (1985): Entwürfe eines antifaschistischen Volksstücks nach 1945, in: Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst 40/1–2, S. 35–39.
- Schütze, Peter (1994): Fritz Kortner. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (Rowohlts Monographien 531).
- Servus (1949): Weißt du noch, München? In: Salzburger Nachrichten vom 13. Juni 1949, S. 5. Abgerufen von https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19490613&seite=5&zoom=33, Zugriff am 28.12.2023.
- Sonnleitner, Johann (1996): Hanswurst, Bernardon, Kasperl und Staberl, in: ders. (Hg.): Hanswurstiaden. Ein Jahrhundert Wiener Komödie. Salzburg/Wien: Residenz, S. 333–389.
- Sonnleitner, Johann (2016): Die Gruppe 47 und die österreichische Nachkriegsliteratur, in: Jaroslaw Lopuschanskyj/Oleh Rachenko (Hg.): Tagungsband der 4. Österreich-Tage in Drohobytsch (27. September – 3. Oktober 2015). Innsbruck: Posvit (Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen 4), S. 48–56.
- Spies, Bernhard (1997): Die Komödie in der deutschsprachigen Literatur des Exils. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie des komischen Dramas im 20. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Stocker, Günther (2019): Zum Nationalsozialismus in der österreichischen Gegenwartsliteratur: Paulus Hochgatterers Erzählung Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war (2017), in: Studia Germanica Posnaniensia 40, S. 63–74. DOI: 10.14746/sgp.2019.40.06.
- Strigl, Daniela (1997): Worüber kein Gras wächst. Hans Leberts politische Lektion, in: Gerhard Fuchs/Günther A. Höfler (Hg.): Hans Lebert. Graz/Wien: Droschl (Dossier 12), S. 117–142.
- Theater Spielraum (2015): Donauwellen von Fritz Kortner. Abgerufen von https://theaterspielraum.at/donauwellen/, Zugriff am 28.12.2023.
- Völker, Klaus (1993): Fritz Kortner. Schauspieler und Regisseur. 2., durchges. u. um ein Reg. erw. Aufl. Berlin: Hentrich (Stätten der Geschichte Berlins 27).
- Völker, Klaus (2009): Fritz Kortner, in: Wilhelm Kühlmann (Hg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Bd. 6: Huh–Kräf. 2. Aufl. Berlin/New York: De Gruyter, S. 656–657. DOI: 10.1515/9783110213942.
- Weinzierl, Ulrich (2002): Wenn alle untreu werden. In: Die Welt vom 23. November 2002. Abgerufen von https://www.welt.de/print-welt/article269308/Wenn-alle-untreu-werden.html, Zugriff am 29.01.2024.
Anmerkungen
Top of pageSchriftliche und geringfügig erweiterte Fassung meines gleichnamigen Vortrags auf der Tagung Krieg und Frieden. Verhandlungen in der Literatur und anderen Medien am 24. November 2023 im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Stellvertretend für das gesamte Organisationsteam danke ich Dîlan Canan Çakir.
Back