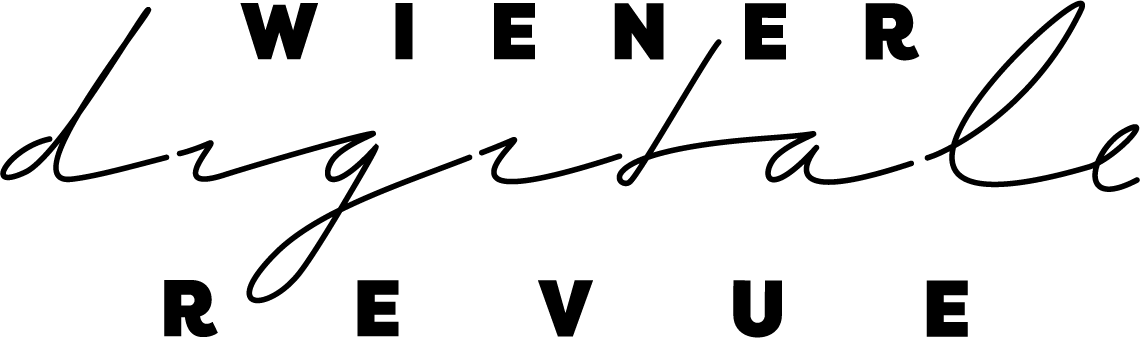
Zeitschrift für Germanistik und Gegenwart
Florian Ronc
Wiener Mode: Eine Geschichte des schlechten Geschmacks
Lizenz:
For this
publication, a Creative Commons Attribution 4.0 International license
has been granted by the author(s), who retain full
copyright.
Link
Wiener Digitale Revue 6 (2025)
www.univie.ac.at/wdrAbstract
Top of pageInhalt
Top of pageVolltext
Top of pageVor mir auf dem Bildschirm ein Pastell von Liotard, das werbewirksame „Schokoladenmädchen“, gekleidet in einen blaugrauen, von Unterkonstruktionen zu einer Glocke geformten Seidenrock, eine schneeweiße Schürze. Dazu ein kurzes, senffarbenes Jäckchen aus Samt, dessen Rückteil schleifenartig ausläuft, mit enganliegenden Ärmeln, die sich vom Ellenbogen abwärts erweitern. Auf seinem Kopf thront eine Haube aus rosa Seide, mit einem hellblauen Seidenband geschmückt und mit weißer Spitze gesäumt, an den Füßen pastellgelbe Seidenschuhe mit hohem Absatz.1 Diese junge Frau steht mitten in der Welt. Beinahe haptisch, fotorealistisch dargestellt, in einem Medium, das keine Berührung toleriert, ohne zu verwischen. Ist das Schokoladenmädchen eine Type, ein schönes Ideal ohne Realitätsbezug?
Aus demselben Jahr betrachte ich ein Portrait der sechsjährigen Marie-Antoinette, die bestimmt und leicht arrogant die Betrachter:in anschaut. Bis auf eine kleine blaue Schleife ist das Bild in zwei Farben gehalten: Rosa und Weiß. Sie trägt ein rosa Seidenkleid mit schleifenbesetzter Front, ein gekräuseltes Seidenband um den Hals und ein passendes, zwischen Schleife und Raffung changierendes Stoffstück auf dem Kopf, und – das ist der Kern des Bildes – ein Webschiffchen in der Hand, in das sie rosa Garn einspannt.2 Die beiden Bilder stehen in einem krassen, befremdlichen Kontrast: Das Dienstmädchen wird als Konsumentin, die Erzherzogin als Produzentin dargestellt. Was geschieht hier?
Je länger ich mich mit Wiener Mode beschäftige, desto unmöglicher erscheint mir das Unterfangen, wie etwa Lucie Hampel (1976) eine kohärente Geschichte zu erzählen. Repräsentative Hofportraits (vgl. Sandbichler et al. 2021), festliche Ballkleider, von Makart inspirierte Aufmachungen, elegante Damen der Jahrhundertwende, die Geradlinigkeit der Wiener Werkstätten (vgl. u.a. Thun-Hohenstein et al. 2019; Pallestrang 2024; Bonnefoit/Celio-Scheurer 2023), die Modeschule in Hetzendorf, die Modeklasse an der Angewandten – was in Wien produziert und getragen wird, ist vor allem eines: schön. An der Fassade von Kniže am Graben prangt in goldenen Lettern: New York – Paris – Bad Gastein. Ich muss schmunzeln. Was mir bei meinem Spaziergang durch die Stadt begegnet, ist überkommen, unpassend, ungelenk, grauenhaft bis unfreiwillig komisch, Inbegriff des schlechten Geschmacks. Mich beschleicht das Gefühl, dass Wiener Mode mehr ist als die Dinge, die uns auf Abbildungen verkauft werden. Vielleicht muss das Phänomen von seiner Kehrseite betrachtet werden. Vielleicht – und so bildet sich eine erste These – ist der schlechte Geschmack ein inhärentes Moment. Schlechter Geschmack ist alles, was gewollt, aber nicht gekonnt ist. Schlecht meint aber gerade nicht geschmacklos, sondern unbeholfen, schwierig, gemein, übel, ungezogen, böse, verdorben, missglückt, schlimm – Bedeutungen, die im englischen bad klarer werden. Die zweite These, die sich für die weitere Arbeit bewährt: Mode ist immer eine Einheit von Kleidung und Körper, von Objekt und Raum.
Von diesen Demarkationen ausgehend, versucht sich dieser Artikel in Sondierungsgrabungen, Fallstudien, Aussichten auf selten erzählte Aspekte. Dabei wird die Differenzierung zwischen Mode in und Mode aus Wien unbrauchbar – stattdessen verwende ich im Folgenden den weiter gefassten Begriff der Wiener Mode. Selbst die historischen Grenzen, die Wiener Mode mit dem Wiener Kongress beginnen und mit den Wiener Werkstätten enden zu lassen, sagen wenig darüber aus, wie sich spezifische Erscheinungen überhaupt erst herausbilden konnten. Mein kurzer Beobachtungszeitraum von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglicht es, auf frühe Tendenzen der Devianz, der Grenzüberschreitung und des subversiven Potentials hinzuweisen. Dieser Artikel, ein methodischer Gemischtwarenladen, versucht daher die Bestimmung von modischen Phänomenen ex negativo. Die bisweilen schlechte Quellenlage kann dabei nicht nur ein Defizit sein – sie öffnet auch Räume für methodische Vielfalt (vgl. Wagner 1986).
Do it Yourself! // Maria Theresia und die Fast Fashion
Schon in den frühsten Texten zur Wiener Mode (vgl. Seifried Helbling 1886) werden drei Störfaktoren benannt: die Gefahr, Standesunterschiede zu verwischen, die Einbettung in ein internationales Netzwerk und das Fehlschlagen jeder Regulierung. Die Begeisterung des Bürgertums und der Bäuer:innen für Farben, Textilien und internationale Trends, kurzum die Objekte der Begierde einer hochgradig konsumorientierten Gesellschaft, bedeutet eine Verortung in der Welt und im sozialen Gefüge (vgl. Rublack 2022).3 Luxuria, die sündhafte Verschwendungssucht, ist eine Lebenseinstellung. Konsum, das wird dabei deutlich, beschäftigt die Unterschicht und die breite Gesellschaft. Sie produzieren die Güter, um sie selbst zu verbrauchen. Das Rad dreht sich immer schneller (vgl. ebd.: 21–23).
Die schiere Menge an Erlassen und Kleiderordnungen, mit denen Europa überschwemmt wird, sind Ausdruck einer Hilflosigkeit. So ambitioniert Gesetze auch versuchen, Einfluss auf die für Luxusartikel aufgewendeten Kapitalmengen zu nehmen (vgl. ebd.: 12; 98–99) – befolgt werden sie nie. Gerade in Wien scheitern sie regelmäßig an der Ignoranz der Einwohner:innen und werden kurz nach ihrer Veröffentlichung wieder aufgehoben (vgl. Walter 1976: 9). Statt sie als reine Einschränkungen zu lesen, hilft ein Perspektivwechsel: Verbote reagieren immer auf eine bestehende Konsumkultur, dulden oder fördern gar bestimmte Praktiken. Spätestens im 17. Jahrhundert tendieren Modeerlasse immer mehr zu kleineren, kontrollierbaren Geltungsbereichen. Die Kleiderordnungen Karls VI. etwa interessieren sich längst nicht mehr für Standeszugehörigkeit, sondern beschränken sich zunehmend auf Importbeschränkungen (vgl. Maria Theresia 1893 [1762/1763]: 341). Mit einer gewissen Resignation und gleichzeitig regelrecht obsessiv nimmt sich Maria Theresia wiederholt der Verschwendungslust an.4 In einem Handschreiben aus dem Jahr 1762 fordert sie eindringlich von ihrem Hofrat einen Gesetzesentwurf zur Eindämmung des Luxus. Ihre Bevölkerung, so fürchtet sie, könnte durch den Abfluss beträchtlicher Geldmengen ins Ausland nicht nur sich selbst, sondern den Staat als Ganzes schwächen (vgl. Maria Theresia 1893: 342). Die Antwort des Kommerzienrates bestätigt ihre Diagnose zwar, weist jedoch auch darauf hin, dass solche Erlasse in einer Residenzstadt zum Scheitern verurteilt seien. Vielmehr sei mit dem Widerstand von Manufakturarbeiter:innen und Kaufleuten zu rechnen, deren Existenz – insbesondere im Textilzentrum Wien – von einer Luxusindustrie abhängig ist (vgl. ebd.: 343). Er schlägt daher vor, lediglich den Abfluss von Kapital ins Ausland einzudämmen und die heimische Modebranche zu stärken, statt sie zu regulieren. Die Idee dahinter ist, das Konsumverhalten der Gesellschaft sogar zur Sanierung des Staatshaushalts zu nutzen, indem sie mit hochwertigen Rip-Offs zu günstigeren Preisen versorgt wird (vgl. ebd.: S. 343–345). Ganz ohne das Zutun der Textillobby ist dieser Vorschlag freilich nicht zustande gekommen.5 Tatsächlich billigt Maria Theresia den Gegenentwurf, beharrt aber auf dem Problem des Schmucks, gegen dessen heimlichen Import auch ihr Kommerzienrat keine Lösung gefunden hatte (vgl. ebd.: 344). Obwohl sich in Wien allmählich eine Kunstperlenindustrie etabliert hat und Silber längst aus heimischen Bergwerken gewonnen wird, müssen die meisten der begehrten Materialien importiert werden. Die ungeheuren Summen sind offenbar Anlass zur Sorge, und obwohl sie perspektivisch auch dem eigenen Hof an den Kragen will, merkt Maria Theresia an, dass das Pferd von hinten aufzuzäumen ist. Im August 1763 formuliert sie eine mühsame Aufstellung, wer wann welchen Schmuck zu tragen habe:
In Ansehung des Geschmucks unter dem 4. July erstatteten Vortrag habe Ich das Einrathen in deme zu begnehmigen gefunden, dass der mässige Gebrauch des Geschmucks […] denen Personen von minderem Rang gänzlich verboten und diese Mässigung respectu deren erstem dahin bestimmt werde, dass die Männer Ringe und die ihnen zustehenden Orden auch das von Mir erhaltene Portrait mit Geschmucks besetzter, die Frauen aber nebst denen Ringen, Ohrgehängen, eine mässige Zierde um den Hals und eine einzige Egrette oder Schlupfe und dieses zwar nur auf einige Zeit zu tragen befugt sein sollen ; allermassen Ich nach 5 Jahren die Tragung des Geschmucks vollkommen zu verbieten geneigt bin. […] Am ersten ist annoch diese Vorsehung bey dem Burger und Bauernstand erforderlich [und] nicht bey dem Adel und übrigen höheren, sondern bey dem geringsten Stande der Anfang zu machen seyn wolle (ebd.: 347f.).
Es sind also die Bäuer:innen und Bürger:innen, die Breite der Gesellschaft, bei der sie ansetzen will, um Dinge im großen Maßstab zu verändern. Dass ihr Unterfangen genauso hoffnungslos ist wie die Erlässe früherer Jahrhunderte, wird ihr offenbar bewusst, die politischen Bemerkungen zum Thema Mode reißen ab. Zwar kann sie bei Hofe als Vorbild wirken,6 doch der Kreis derer, auf die die Regentin direkten Einfluss ausüben kann, beschränkt sich auf ein Minimum (vgl. Hengerer/Drossbach 2021: 9–24). Sie selbst verliert das Interesse an der Verknüpfung von Mode und Verderben ihr Leben lang nicht. Die Frage, die sie dreizehn Jahre später umtreibt, ist aber eine ganz andere: Wie kann ausgerechnet ich ein derart missratenes Kind haben?7
Body Shaming, Body Shaping // Ideale Nacktheit
Mit der Mode verbunden ist immer auch die Frage nach dem Körper. Maria Theresias Briefe an ihre Tochter strotzen vor Kritik und vor Zweifel an deren moralischer Integrität – nicht zuletzt aber an ihrer Figur. Ganz selten tauchen in dieser Sammlung an Ratschlägen, Beschwerden, Entsetzen wohlwollende Passagen auf. Maria Theresia lässt sich von einem dichten Netz an Korrespondent:innen, Kurieren, Gesandten und Malern bis ins letzte Detail über den Zustand Marie-Antoinettes informieren.8 Bereits ein halbes Jahr nach der Hochzeit kommt Marie-Antoinettes Veränderung zur Sprache:
[Le] courrier, qui était à votre suite; il vous trouve grandie, et engraissée. Si vous ne me l’assuriez sur le corps, que vous portez, cette circonstance m’aurait inquiété, crainte, comme on dit en Allemand: auseinandergehen. […] La Windischgraetz […] m’a avoué que vous négligez beaucoup et même sur la propreté des dents; c’est un point capital de même que la taille, qu’elle a aussi trouvée empirée […]; elle a aussi ajouté que vous êtes mal mise […]. J’ai pensé si vous vouliez m’envoyer une bonne mesure, vous faire ici des corps ou corsettes. On dit que ceux de Paris sont trop forts; je vous les enverrai par courrier. […] Liotard […] va par exprès à Paris pour […] m’ […] envoyer [un portrait] (Maria Theresia/Marie-Antoinette 1865 [01.11.1770]: 8–11).9
Trotz der drastischen Wortwahl10 fehlt ein wesentlicher Punkt in den Briefen: So unglücklich sie über die Verfassung Marie-Antoinettes sein mag – die Aufforderung abzunehmen, findet sich an keiner Stelle. Das zentrale Problem ist vielmehr, dass die Kleidung der Tochter „nicht passt“.11 Konsequenterweise stellt Maria Theresia die Möglichkeit in den Raum, die offenbar steiferen französischen Korsette schlicht gegen flexiblere Wiener Versionen auszutauschen.12 Dass das Korsett direkt in die Physis eingreift, steht – entgegen einer verbreiteten Lesart dieses Kleidungsstücks – nicht zur Debatte.13 Zentral ist die Frage nach den Proportionen. Die Taille, die Maria Theresia nicht verändern kann und will, ist in der Praxis des 18. Jahrhunderts eine optische Illusion: Nicht die Diminuation der Körpermitte ist das eigentliche Unterfangen, sondern die gezielte Augmentation von Schultern (durch Polsterungen in Miedern, Schulterpolster, Tücher, Puffärmel, Raffungen) und der unteren Körperhälfte (durch mehrere Lagen von Röcken, und Unterkonstruktionen wie dem Panier, den Bauschungen von Jacken und hohe Schuhe – was von der Frühen Neuzeit bis zur Neuen Tracht der Nachkriegszeit gilt). Die weitestgehend ahistorische Deutung von Korsetten fußt auf zeitgenössischen Texten, die ein Scheinproblem kreieren und bis heute ihr Unwesen treiben: Bereits im 18. Jahrhundert erscheinen unzählige Abhandlungen von Autoren – überwiegend Medizinern (vgl. u.a. Gerber 1735; Soemmerring 1788) –, die das Korsett unter dem Deckmantel der Gefahr für die weibliche Gesundheit, wobei vor allem Gebärfähigkeit gemeint ist, kritisieren. (Die spärliche Überlieferung von Stücken, umso mehr aber Portraits und weibliche (Selbst-)Beschreibungen zeugen von einer breiten Palette an Angeboten: Es gibt Korsette für Arbeiterinnen, Schwangere, Reiterinnen etc.) Diese Männer tun ihre Verachtung kund, reagieren gehässig und besorgt auf jede Form der Körpermodifikation – was auch für Make-Up gilt (vgl. Eldridge 2015) –, scheitern aber an der Beharrlichkeit, mit der sich Frauen gegen solche Einflussversuche wehren. Anstatt das als hässlich oder schädlich titulierte Kleidungsstück fügsam abzulegen, ist beinahe das Gegenteil der Fall. Das Korsett, so eine andere Lesart, kann Ausdruck einer selbstbestimmten physischen, moralischen und nicht zuletzt politischen Aufrichtigkeit sein.14 Formung, Passung und Angemessenheit spielen zusammen. Die Briefe Maria Theresias sind damit nicht (nur) Zeugnisse persönlichen Body Shamings, sondern eine intensive Auseinandersetzung mit dem Wesen der Mode, Ausdruck der Vorstellung, dass Kleidung erst zu Mode wird, wenn sie mit dem Körper eine Verbindung eingeht.
Die Theorie und Praxis der Mode wird in einem neuen Medium um die Komponente der Präsentation radikal verändert: In den Zeitschriften, die ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts von Paris bis Wien aus dem Boden schießen, dienen Frauenfiguren in erster Linie als Kleiderständer, als illustrativer Nicht-Körper.15 Zum ersten Mal wird Mode von der Physis getrennt und ein standardisierter, unveränderlicher weiblicher Körper vorausgesetzt. Je populärer und erschwinglicher Mode wird, desto stärker rückt das Privileg der guten Figur in den Vordergrund. Die Abbildungen, mit denen das (weibliche) Publikum regelrecht überschwemmt wird, kehren eine wesentliche Logik der Mode um: Statt Körper durch den Einsatz vielfältiger Augmentationen und Diminutionen zu erweitern, bilden von nun an Körperideale die Voraussetzung einer modischen Teilhabe. Während vordergründig lediglich neue Modetrends vorgeführt werden, beginnt implizit die Gleichsetzung des schönen Körpers mit dem nackten Körper. Wie sehr diese Vorstellung lange vor Size Zero auf die eigene physische Erscheinung rückwirkt, wird in Wien besonders am Beispiel Kaiserin Elisabeths deutlich: Einerseits verschmilzt sie in allgegenwärtigen Portraits mit ihren Kleidern zu einer Skulptur,16 andererseits formt sie durch Hungerkuren und fanatischen Sport die eigenen Dimensionen. Das Signal ist klar: Konnte noch vor einigen Jahrzehnten niemand wie Maria Theresia gekleidet sein, weil schlicht das Kapital fehlte, birgt das Schlankheitsideal zumindest das Versprechen, sich der Kaiserin anzunähern. Die neue Ikonographie von Kleidung – die in meinem Verständnis durch ihre Körperlosigkeit nicht mehr als Mode verstanden werden kann – birgt permanent das Potential zu scheitern. Mit Kleidung, die in der Praxis nicht an Puppen hängt, laufen Frauen nicht mehr die Gefahr, schlecht gekleidet zu sein, sondern nicht die Figur zu haben.17 Mit der Befreiung in der Imagination entstehen neue Zwänge in der Umsetzung.
Recycling, Upcycling // Stifter und der Tod der Dinge
Ging es bisher vor allem um das Anziehen von Kleidern, steht an dieser Stelle das Abgelegte im Fokus. Mode als Kommunikationssystem aller Klassen beruht nämlich nicht nur auf durch Bilder vermittelten Trends, sondern auch auf der Netzwerkbildung über physische Objekte. Modewandel bedeutet vor dem Wirtschaftswunder der 1950er und 1960er Jahre nicht die ständige Anschaffung von Neuem, sondern den kreativen Prozess der Adaption. Während kurzfristige Umarbeitungen schnell auf Innovationen reagieren können, spielt die generative Kommunikation über Wiederverwertung, Schenkung und Vererbung eine wichtige Rolle. Kleider werden hier zur Währung – und damit zu einem Gut, das permanent gepflegt und verfügbar gehalten werden muss (vgl. Rublack 2022: 22f.). Das Besondere an dieser Form des Wirtschaftens ist, dass alle Beteiligten an Status gewinnen: Die Schenkerin hält sich durch Objekte in Erinnerung, die Beschenkte kann nicht nur modisch brillieren (und damit Kategorien der sozialen Klasse aufweichen), sondern gleichzeitig auch (etwa als Bedienstete) den Status des Hauses repräsentieren (vgl. ebd.: 242) – es entsteht ein geschlossener Kreislauf an Prestige. Wie kaum ein anderer Gegenstand vermag Kleidung soziale Netzwerke sichtbar zu machen. Erweitert man den Austausch zwischen Einzelpersonen um den Faktor professioneller Händler:innen, entsteht ein eigener Wirtschaftssektor. Stifters Tandelmarkt liefert ein Beispiel für diesen – im Text zumindest in seiner Ausdehnung als Wiener Spezifikum benannten – Upcycling-Betrieb:
[V]on dem kostbaren Perlenschmuck und der goldenen Cilinderuhr an bis zu dem einzelnen verrosteten Schuhnagel herab, von den Zobel- und Hermelinpelze bis zu dem vertretenen Stallpantoffel, von Silber, Borden und Seidengeflechte bis zu altem weggeworfenen Riemwerk und Leder. Alle Stände, alle Alter und Geschlechter, alle Zeiten sind hier repräsentiert (Stifter 1844: 231).
Das Verlockende an diesem Einkaufsparadies ist (neben der kostengünstigen Anschaffung für Kund:innen und der immer noch großen Gewinnspanne der Händler:innen) die Möglichkeit, Kleidung sofort zu erwerben und gegebenenfalls rasch vor Ort anpassen zu lassen, ohne auf lange Wartezeiten bei Schneider:innen angewiesen zu sein. Auf dem Markt finden sich auch neue Stücke, die zuerst einmal nicht auf einen bestimmten Körper zugeschnitten sind und daher potenziell auch nicht gekauft werden müssen. Kurzum alles, was Konsumimpulse auf der Stelle befriedigen kann. Doch Stifters durch und durch wienerischem Text ist der Tod an allen Ecken und Enden eingeschrieben. Bereits die lange Einleitung zu der verhältnismäßig kurzen Erzählung handelt von der Melancholie, die das Alte als Zeugnis und Erinnerung an die unwiederbringlich verlorene – aber unbestimmte – Vergangenheit hervorruft. Umso akribischer versucht Stifter möglichst viele Gegenstände zu schildern, um sie dem Verschwinden zu entziehen.18 Der Markt selbst wird zu einem Friedhof der „Dinge, die im Leben himmelweit auseinander standen, […] [und die] hier friedlich und ebenbürtig beisammen[liegen]“ (Stifter 1844: 231). Die Egalität des Konsums ist ewiger Friede und Fegefeuer zugleich, denn „wie Delinquenten hängen die Röcke gebürstet, gepreßt und herausgeputzt, die Kappen und Mützen gaffen und glotzen auf den Bänken, […] und Frauenröcke und Schürzen sträuben sich“ (ebd.: 233). Mit jedem gescheiterten Handel rückt die Vergänglichkeit bedrückend nahe – und selbst im wörtlichen Sinne sind die einen oder anderen Verkaufsgüter mit dem Tod in Berührung gekommen (vgl. ebd.: 234f.). Nicht zuletzt ist eines sicher: Auch der Tandelmarkt selbst wird verschwinden (vgl. ebd.: 230). Interessant für meine These, dass Kleidung erst durch den Körper zu Mode werden kann, ist das völlige Fehlen eines engen Modebegriffes im Text.19 Die einzige Möglichkeit, dem Verfall entgegenzuwirken, ist Kleidung zu kaufen und zu tragen.20
Das führt direkt zu einem der wesentlichen Probleme der Forschung oder, genauer gesagt, der Sammlungspraxis. Bisher kommen in diesem Beitrag ausschließlich Texte (im engeren Sinne, aber auch als Bilder) vor. Die Textilien hingegen sind – zumindest als Mode – kaum greifbar. Zwar finden sich in zahlreichen Modesammlungen und Textilmuseen Artefakte (von Dessinentwürfen über Musterbücher bis hin zu Designer:innenstücken). Doch Mode als getragene Kleidung lässt sich selten identifizieren, geschweige denn in generative Systeme einordnen. Sicherlich spielt die begrenzte Haltbarkeit von Stoffen in einem nicht-konservatorischen Umfeld eine gewichtige Rolle. Was nicht mehr tragbar ist, wird früher oder später von Menschen vergessen oder von Motten gefressen. Bedeutender ist aber die Politik von Modesammlungen. Sie führen in extremo die Konzentration des 19. Jahrhunderts auf das Original, das Urtextil vor. Was nicht prototypisch oder intakt genug war, wurde in der Regel verworfen.21 Auch wenn sich die Sammlungspraxis in den letzten Jahrzehnten von einer solchen Perspektive zunehmend abwendet, kann die Zeit nicht zurückgedreht werden. Kleidung als Mode, als in einen sozialen Kontext verwobenes Zeichensystem mit höchst individueller Geschichte ist weitestgehend unrekonstruierbar verloren. Auf die Gegenwart bezogen hängen die Sammlungen noch immer an der Fixierung auf einen Urzustand: Bis heute wollen Museen wenn möglich Designer:innenkleider direkt aus den Ateliers, ohne Modifikationen, ohne Spuren des Gebrauchs. Während sie versuchen, historische Löcher zu stopfen, erweitern sie den Friedhof der toten Dinge.
Fake News // Fadenscheiniger Nationalismus
Was ist nun aber Wiener Mode? Praktisch wäre es, ihren Anfang mit dem Wiener Kongress zu definieren, zwei Labels zu kombinieren, die schon in der Bezeichnung zusammenpassen (vgl. Walther: 12f., Buxbaum 1986: 54ff.). Die Argumente für diese These stützen sich einerseits auf die Emanzipation von dem Diktat Frankreichs in post-napoleonischer Zeit, die Vielzahl an modischen Einflüssen durch die Kongressbesucher:innen oder das Aufkommen der Wiener-Moden-Zeitung 1816. Wie ich versucht habe zu zeigen, bestanden schon lange vor den 1810er Jahren feine, aber bemerkenswerte Eigenheiten der Wiener Mode. Zum anderen rückt die Vorstellung, dass Wien mit dem Kongress zu einem Melting Pot wird, der in der Integration „fremder“ Elemente eine eigene Mode entwickelt, die Stadt an eine historisch nicht haltbare Peripherie. Dass die Wien sich längst in einem regen modischen Austausch mit anderen Herrschaftsgebieten (etwa den Magnat:innen aus den östlichen Reichsteilen, aber auch den Osmanen) befindet, wird bei diesem Ansatz komplett ausgeblendet.22 Zum Dritten konzentrieren sich Analysen der Modezeitungen oft auf die reinen Textpassagen, ohne die Stiche ausreichend zu berücksichtigen.
Und wieder taucht Maria Theresia auf, diesmal in einem Maskenball-Outfit: Martin van Meytens zeigt die Herrscherin in einem „türkischen“ Kostüm aus Samt, Goldposamenten und Hermelin.23 Die Maske in ihrer Hand markiert deutlich: Seht mich an, ich bin verkleidet, ich stehe außerhalb des Alltags. In diesem Bild wird die Osmanophobie zu Gunsten der Staffage zurückgestellt. Die Herrscherin eignet sich das Fremde an, zieht es so nahe an sich, dass sie es anziehen kann. Sie glaubt zu wissen, wie sich osmanische Mode anfühlt – und zumindest was die Materialien betrifft, ist sie bestens informiert. Die Beschränkung auf den heimischen Textilmarkt, die sie so stark propagiert, scheint vergessen. Hier wird deutlich, dass die Faszination sich auf ein Wissen bezieht, das auf einem jahrhundertelangen – nicht bloß militärischen – Austausch mit dem Osmanischen Reich beruht. Stoffe, Muster, Farben werden importiert, kopiert, interpretiert. Rasche Modewechsel von Chinoiserien und Japonerien bis hin zur Mode à la Turque und ungarischen Kostümen spiegeln die Vernetzung Wiens in der Welt wider.24 Jede Neuigkeit wird direkt in Mode übersetzt. So sind mit dem ersten Elefanten in der Schönbrunner Menagerie auf einmal Frisuren „à l’Elefant“25 und 1828 mit der ersten Giraffe „à la Girafe“26 Einflüsse auch von Wien aus verbreiten, lässt sich etwa am Wiener Schal, der auf osmanischen Vorlagen beruht, zeigen. Im späten 18. Jahrhundert wird dieser zum Exportschlager, der seine Reise durch Europa antritt und zu einem regelrechten Must Have avanciert. Dasselbe gilt für auch für reiche, als typisch wienerisch rezipierte Posamente.
Mode ist – und das gilt ganz besonders für Wien – schon früh in einen globalen Kontext eingebunden. Die Dichotomie Wien-Paris wird erst im frühen 19. Jahrhundert schlagend und vermischt sich mit der (bekanntlich aus der französischen Philosophie entlehnten) Forderung nach mehr Natürlichkeit.27 Auf einmal werden bestehende Diskurse und Praktiken nationalistisch aufgeladen. So strotzen die ersten Seiten der kurz nach dem Kongress erscheinenden Wiener-Moden-Zeitung vor hochtrabender Deutschtümelei.28 Eine wahrhafte, dem „Volkscharakter“ entsprechende Mode, so lautet das Postulat, ist vor allem eines: nicht französisch. Um zu sehen, wie wenig erfolgsversprechend diese Idee am Ende ist,29 lohnt sich ein Blick auf die Modestiche, die jeweils am Schluss jeder Ausgabe stehen und besonders angepriesen werden:
Sie liefer[n] treue Abbildungen des Neuesten und Geschmackvollsten, was der durch reiche Erfindung und reinen Sinn für das Zweckmäßige und Gefällige ausgezeichnete und rühmlich bekannte Wiener Modehändler und Erzeuger, Herr Langer, an Frauen-Kopfputz jedes Mahl hervorgebracht hat, und die ersten Damen der Hauptstadt schmückt. (Anonym 1816)30
Wie ist es aber um den Erfindergeist dieser Herrschaften und ihr antifranzösisches Programm bestellt? Beim Wort genommen, bietet sich ein Vergleich der Abbildungen mit denen aus deutschen oder französischen Magazinen derselben Zeit an. Bereits in der zweiten Ausgabe vom 11. Januar 1816 bringt die Wiener-Moden-Zeitung mit der spärlichen Unterschrift „Wiener Moden“ fünf Stiche mit angesagten Hüten. Nummer 5 zeigt ein Häubchen, das vorne mit einer doppelten Rüsche schließt und oben von einem Bouquet aus (Stoff-)Rosen und Blättern geziert wird.31 Im französischen Journal des Dames et des Modes vom 10. Januar 1815, fast auf den Tag genau ein Jahr früher erschienen, findet sich eine praktisch identische Kopfbedeckung – eine Haube aus rosa Velours, abgeschlossen mit derselben doppelt gekräuselten Rüsche und mit demselben Rosenbouquet, betitelt: „Costume Parisien“32. Noch prägnanter ist der Vergleich des „Wiener Ballkleids“ in der Wiener-Moden-Zeitung vom 8. Januar 1818 mit dem „Pariser Ball-Anzug“ aus der Februarausgabe 1818 des Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode33. Die Abbildungen sehen sich verdächtig ähnlich: Beide Kleider sind aus leichtem Atlas mit Saumgarnituren aus demselben Stoff gefertigt, beide Frauen tragen eine auffällige, hoch gesetzte Rosengirlande auf dem Kopf. Selbstverständlich geht die Strategie, französische Mode einfach neu zu betiteln, nicht auf. Die Wiener-Moden-Zeitung bleibt trotz großen Anklangs ein von Werbung und Partikularinteressen motiviertes Medium unter vielen. Internationale Trends kursieren weiterhin in verschiedenen, auch in Wien zu beziehenden Zeitschriften, Korrespondenzen, Modestichen und nicht zuletzt geschickt vermarkteten Importen.34
Ornament and Crime // Die Modistin als Verbrecherin
Die wirtschaftlichen Spielräume, die mit Gender verbunden sind, reduzieren sich in der Regel auf die Erzählung, dass Frauen – wenn sie nicht gerade Kundinnen sind – seit Anbeginn der Zeit lediglich als Arbeiterinnen eine ausführende Funktion in der Textilverarbeitung hatten. Der Perspektivenwechsel, den ich im Folgenden zu unternehmen versuche, bedeutet nicht, den Blick dafür zu verlieren, dass die meisten Frauen (bis heute) unter prekären, oft mehr als gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten. Aber es wäre zu kurz gegriffen, auf eine reine Unterwerfungsgeschichte zu setzen. Mode ist in der Lage, auf allen (Re-)Produktionsebenen Räume zu eröffnen, die eigentlich nicht vorgesehen sind und sich sozialen Konventionen entziehen können. Vollkommen unironisch entwirft etwa Sylvester Wagner die Kehrseite einer hart arbeitenden Frauengemeinschaft, eine radikale Politisierung:
Sie leben untereinander in patriarchalischer Eintracht, einen weiblichen Freistaat bildend, dem es zwar nicht an Männern gebricht […], die aber im Rathe nur Assessoren, im wahren Sinne des Wortes, oder äußere Räthe sind, denen zwar Sitz in den Versammlungen, jedoch aber keine Stimme zukommt. […] Sie teilen sich ihrem Geschäfte nach in zwei Klassen, in die Putz- und ordinären Wäscherinnen, dessenohngeachtet kennen sie untereinander keinen Rangstolz, wie es sich für gute Republikaner auch gebührt (Wagner 1844: 214).
Dass sich Frauen auch jenseits von Berufsgemeinschaften als Einzelpersonen Rang und Namen machen können, wird in der deutschsprachigen Fachliteratur kaum gewürdigt. Die Reduktion der Frau auf die Gattin oder Witwe eines unternehmerischen Mannes, die nur in diesen Rollen eine gewisse Teilhabe an Geschäften erlangen kann, geht einher mit der Idee, dass ohne rechtliche Gleichstellung eine privatwirtschaftliche Führungsrolle undenkbar ist. Besonders in der britischen, aber auch in der französischen Forschung wurde der feministische Diskurs in den letzten Jahren zunehmend auf die frühe Beteiligung von Unternehmerinnen in der Modeindustrie gelegt. Wesentlich ist die retrospektive, verfälschende Trennung zwischen Kleidungsstück und Dekor, die den Blick auf Räume wirtschaftlicher Unabhängigkeit verstellt.35 Noch immer wird in Katalogen nach diesem Schema das „eigentliche“ Kleid von der „Verzierung“ unterschieden. Mode ist aber – um mein Beharren auf der Körperlichkeit noch raumgreifender zu machen – die längste Zeit eine Gesamtanordnung, in der jedes einzelne Teil, von der Unterkonstruktion über die Stoffe und Schmuckstücke bis hin zu Makeup und Frisur gleichberechtigt ist. Jede Schleife ist relevant, kann darüber entscheiden, ob ein Objekt als modisch wahrgenommen wird oder nicht. Im Gegensatz zu den Schneidern, die sich um die Basis kümmern, erzeugen Modistinnen die eigentlichen Trends. Umso überraschender ist es, dass sie (vielleicht ist auch das ein Wiener Spezifikum im Gefolge Adolf Loos’) bis heute marginalisiert werden. In der französischen Kulturgeschichte ist die Figur der Modistin deutlich leichter zu greifen, hat sie doch mit Rose Bertin eine prominente Vertreterin. Schon in zeitgenössischen Polemiken als „Modeministerin“ Marie-Antoinettes verschrien, versorgt sie die Königin in rascher Folge mit neuen Farben und Mustern, lässt diese in ihrer eigenen Manufaktur produzieren und baut ein Netzwerk von Franchisenehmerinnen auf. Darüber hinaus ist sie fest im europäischen Modebusiness verankert und fungiert selbst als Trendsetterin. Gerade in ihrem Fall ist das Dreieck zwischen Ding, Körper und Darstellung ein Dreieck von Frauen: Rose Bertin kleidet die Königin ein, Marie-Antoinette modelt und Élisabeth Vigée-Lebrun malt sie. Das berühmteste Beispiel ist ein weißes Kleid aus Baumwollmusselin, dessen Form durch gezielte Abbindungen mit hellblauen Seidenbändern entsteht. Den Skandal, der in einem Aufstand der französischen Seidenfabrikanten gipfelt, nutzt Bertin nach dem Motto „bad publicity is better than no publicity“. Zwar fertigen die drei Frauen einen zweiten Look an, Marie-Antoinette in einem hellblauen Seidenkleid, um die Wogen vordergründig zu glätten, aber der Trend ist in der Welt (vgl. u.a. Leleu 2003).
Während die Materialien in Großbritannien (wo sich etwa zahlreiche Zeitungsannoncen von Mantua-Makers erhalten haben, die gezielt Frauen für eine Ausbildung anwerben) und in Frankreich (wo Patente und Gerichtsakten das Selbstbewusstsein der Zünfterinnen belegen) gut aufgearbeitet sind, steht für die Wiener Industrie eine solche Quellensichtung noch aus.36 So sind ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts – mit der Verbreitung eingenähter Etiketten – zwar diverse Unternehmerinnen wie Albine Rädler, Betti Galimberti oder Johanna Schenk zumindest namentlich bezeugt, doch eine Beschäftigung mit ihrer Rolle im Wiener Modesystem bleibt bisher ein Desiderat.
Sex sells // Der Anti-Bürger
Was bisher ebenso fehlt, ist ein Blick auf Männermode. Die Geschichte, die in der Regel erzählt wird, lautet folgendermaßen: Vom ausgehenden 17. Jahrhundert gibt es bis auf die Kniehosen kaum einen Unterschied zur Frauenkleidung. Es sind dieselben Stoffe und Dessins, die Seidenstrümpfe, die hohen Schuhe.37 Danach kommt die Abkehr vom Ancien Régime mit den Sansculottes und ihren Hosen, ein letztes Aufbäumen von Farben und Mustern, schließlich die Durchsetzung dunkler Stoffe.38 Auch in den Modesammlungen lässt sich diese Abfolge nachvollziehen, wobei die Exponate ab dem 19. Jahrhundert spärlicher werden. Wer will denn schon das tausendste Sakko mit minimalen Änderungen der Silhouette sehen? Höchstens im Heeresgeschichtlichen Museum wird es ein wenig bunter, die Uniformen machen doch etwas her. Es scheint, als gäbe es zwischen Rokoko und Westwood keine Mode für Männer, die den Namen verdient.39 Die Vorstellung, Männermode sei schlicht uninteressant, weil sie nicht so schön schillert, folgt einer Selbstbeschreibung ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach dem krachenden Scheitern der 48er-Revolution entsteht ein konservativer Mainstream. Was in der reaktionären Phase des Biedermeiers beginnt, ist eine Eigendefinition des Mannes als mündiger Bürger. Mode wurde zur Beschäftigung von Menschen, die keine staatstragende Funktion haben (also Frauen). Der Bürger hat als Stütze der Gesellschaft schlicht keine Zeit für Trends. In seiner völligen Körperlosigkeit kann er nicht zum Träger werden. Überraschenderweise geht mit dieser Entwicklung keine Politik der Ächtung einher – alles, was anders ist, wird ignoriert oder höchstens verspottet. Selbst Revolutionsmode nach französischem Beispiel kann im durch und durch absolutistischen Wien nicht provozieren – sie wird sogar, im Bewusstsein der inhaltlichen Leere der Wiener Gesinnung, geduldet und als Requisit der Jugend toleriert.40 Während Männer vor allem über die medizinische und moralische Integrität von Frauen nachdenken, scheinen sie höchstens ein beschränktes Interesse an Randerscheinungen zu haben. Die satirischen Auseinandersetzungen konzentrieren sich – im Kontext devianter Männlichkeit – auf unpassende Kleidung, die als Ausdruck eines unpolitischen Objekts konstruiert wird.41 Der prototypische Dandy als Gegenstück des seriösen Mannes entzieht sich zwei zentralen Aufgaben des Bürgers: Einerseits verkörpert er mit seiner Obsession und dem zeitlichen Ressourcenaufwand für Kleidung das Gegenteil des produktiven Staatsbürgers, andererseits widerstrebt er der neu definierten Hypermaskulinität des authentischen Subjekts. Der Dandy ist fake und faul – und er überschreitet die neue Grenze zwischen öffentlich und privat. Im neokonservativen Wien des 19. Jahrhunderts ist er schon als Import aus England mit einer Vorliebe für alles Französische verdächtig. Obwohl Dandys und ihre Artgenossen42 ein internationales Phänomen sind, bewegen sie sich immer in einem spezifischen Kontext. Sylvester Wagner verlagert den Dandy in einem Beitrag zu Wien und die Wiener bezeichnenderweise in ein Modegeschäft, als verführerische Figur, die Konventionen überschreitet und mit ihrem „schmachtende[n], nichtssagende[n] Blick“ (Wagner 1844: 3) den Akt des Kaufens erotisiert. Der Ladendiener ist nicht an der Frau interessiert, sondern an Konsum und Kapital. Sein Konzept der Kundin ist egalitär und seine Sprache selbst international und kreativ (vgl. ebd.: 3, 5). Er ist durch und durch oberflächlich.
Gewöhnlich trägt der Ladendiener alle Gattungen Bärte, die nur immer in seinem Gesichte Platz finden; das Haar ist sorgfältig in Locken gelegt und von Pomade triefend; um den geschnürten Körper schmiegt sich ein moderner Frack, in dessen Knopfloch eine Rose prangt als Abzeichen seiner Verehrung für das Damengeschlecht; die Cravate ist stets nach dem neuesten Geschmacke und vollendet das Fashionable seines Anzuges. […] [S]eine Sprache ist – wenn auch nicht gewählt – doch gesucht; er bedient sich gerne fremder Ausdrücke, ohne ängstlich zu sein, ob selbe dahin passen, wo er sie anwendet […]. Ueber sein ganzes Wesen ist eine Selbstzufriedenheit ausgegossen, die wahrhaft zu beneiden ist […]. Wo der Ehemann und Geliebte vergebens bitten und beschwören, siegt Ein Wort des Ladendieners. […] [Er] vermeidet mit ängstlicher Sorgfalt alles Imponirende und Kräftige, das ihm sonst so sehr zu Gebote steht, und trachtet dafür nach dem Sanften und Lieblichen, das ihn nicht minder gut kleidet (ebd. 3f.).
Als ambivalente Figur zwischen erotischer Aufladung und Verweichlichung ist er gleichermaßen affig wie erfolgreich. Ein Anti-Werther ohne Empfindung, ein Anti-Bürger ohne Pflicht.
Ohne Mode als disruptive Kraft zu betrachten, können Kommunikationssysteme nicht verstanden, ideologische Entwürfe nicht auf ihr Scheitern untersucht, Marginalisierungen nicht revidiert werden. Dieser kleine Aufschlag in der Auseinandersetzung mit Wiener Mode bedeutet vor allem eines: Sie ist immer hybrid und körperlich. Ungetragene Kleidung hingegen wird unheimlich, giert nach Körpern, lauert als Wiedergänger der potenziellen Kundschaft auf. Mode ist immer auch eine Praxis des Unpraktischen. In einem Überschuss kann sie soziale Grenzen sprengen, sei es als Widerstand gegen Regulierungsversuche, als Weigerung, auf eine gegebene Physis reduziert zu werden, als Voraussetzung für weibliches Unternehmerinnentum, als Gegenentwurf zum Nationalismus oder schlicht aus Unlust, sich in staatstragende Subjekte zu verwandeln. Denn das beste Argument, sich unangenehmen Erwartungen zu entziehen, bleibt immer noch: Ich habe nichts zum Anziehen.
Literaturverzeichnis
Top of page-
Literatur
- Anonym (1816): Plan und Zweck des Wochenblattes, in: Wiener-Moden-Zeitung (04.01.1816), S. 6–8.
- Anonym (S.H.) (1816): Ein Wort über Kleidertracht und Mode, in: Wiener-Moden-Zeitung (04.01.1816), S. 2–6.
- Bonnefoit, Régine/Celio-Scheurer, Marie-Eve (Hg.) (2023): Tracing Wiener Werkstätte Textiles. Viennese Textiles from the Cotsen Textile Traces Study Collection. Basel: Birkhäuser.
- Buxbaum, Gerda (1986): Mode aus Wien. 1815–1938, hg. von der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Salzburg/Wien: Residenz.
- Crowston, Clare (2000): Engendering the Guilds: Seamstresses, Tailors, and the Clash of Corporate Identities in Old Regime France, in: French Historical Studies 23/2, S. 339–371.
- Eldridge, Lisa (2015): Face Paint: The Story of Makeup. New York: Abrams Image.
- Elizabeth Seymour Percy, Duchess of Northumberland (1926): The Diaries of a Duchess. Extracts from the Diaries of the First Duchess of Northumberland (1716–1776), hg. von James Greig. London: Hodder & Stoughton.
- Hampel, Lucie (1976): 200 Jahre Mode in Wien. In: 200 Jahre Mode in Wien. Aus den Modesammlungen des Historischen Museums der Stadt Wien, hg. vom Verein der Freunde der Hermesvilla. Wien: Eigenverlag der Freunde der Hermesvilla, S. 19–30.
- Hengerer, Mark/Drossbach, Gisela (2021): Zur Einführung. Adel im östlichen Europa zwischen Lokalität und Transnationalität, in: Dies. (Hg.): Adel im östlichen Europa. Zwischen lokaler Identität, Region und europäischer Integration. Berlin: Frank & Timme, S. 9–24.
- Hensel, Titia (2023): Das Bild der Herrscherin. Franz Xaver Winterhalter und die Gattungspolitik des Porträts im 19. Jahrhundert, Bd. XXVI. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1858 (1858). Wien: Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei.
- Inder, Pam (2020): Busks, Basques and Brush-Braid: British dressmaking in the 18th and 19th centuries. London: Bloomsbury Visual Arts.
- Leleu, Fanny (2002): La mode féminine à Bordeaux (1770-1798), in: La culture matérielle dans le Midi de la France à l’époque moderne 115/241 (2003), S. 103–114.
- Kammel, Frank Matthias (2001): Gefährliche Heiden und gezähmte Exoten: Bemerkungen zum europäischen Türkenbild im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: Asch, Ronald/Voß, Wulf Eckart/Wrede, Martin (Hg.): Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die außereuropäische Welt. München: Wilhelm Fink, S. 503–525.
- Maria Theresia (1893 [1762/1763]): Zwei Handschreiben von Maria Theresia über den Luxus, in: Zeitschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte, 1. Bd., 2/3 (1893), S. 341–348.
- Maria Theresia/Marie-Antoinette (1865): Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr Briefwechsel während der Jahre 1770–1780, hg. von Alfred von Arneth. Paris/Wien: Jung-Treuttel/Braumüller.
- Maria Theresia/Marie-Antoinette (2017): Maria Theresia und Marie Antoinette. Der geheime Briefwechsel, hg. von Paul Christoph. Darmstadt: Lambert Schneider.
- McKever, Rosalind/Wilcox, Claire (Hg.) (2022): Fashioning Masculinities. The Art of Menswear. London: V&A Publisher.
- Pallestrang, Kathrin (2024): Enchanting Fragments. The Emilie Flöge Collection in the Volkskundemuseum in Vienna, in: Staggs, Janis (Hg.): Klimt Landscapes. München/London/New York: Prestel, S. 208–239.
- Gerber, Traugott (1735): De Thoracibus, Von Schnürbrüsten. Leipzig: Langenheim.
- Rublack, Ulinka (2022): Die Geburt der Mode. Eine Kulturgeschichte der Renaissance. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sandbichler, Veronika/Schmitz-von Ledebur, Katja/Zeisler, Stefan (Hg.) (2021): Mode schauen. Fürstliche Garderobe vom 16. bis 18. Jahrhundert. Berlin: Hatje Cantz.
- Schillig, Anne (2015): Geliebt und verfemt: Das Korsett – Diskursgeschichte eines Kleidungsstücks. Luzern: Universität Luzern/Historisches Museum Luzern.
- Seifried Helbling [Notname] [um 1300] (1886), hg. von Joseph Seemüller. Halle/Saale: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.
- Soemmerring, Samuel Thomas von (1788): Über die Schædlichkeit der Schnürbrüste. Leipzig: Crusius.
- Söll, Änne (2023): Some faggy gestures. Queere Perspektiven der Kunstgeschichte, in: Hecht, Lisa/Ziegler, Henrick (Hg.): Queerness in der Kunst der Frühen Neuzeit. Köln: Böhlau, S. 31–37.
- Stifter, Adalbert (1844): Der Tandelmarkt, in: Ders. (Hg.): Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben. Pest: Gustav Heckenast, S. 227–241.
- Thun-Hohenstein, Christoph/Schmuttermeier, Elisabeth/Witt-Dörring, Christian (Hg.) (2019): Koloman Moser. Universalkünstler zwischen Gustav Klimt und Josef Hoffmann. Basel/Wien: Birkhäuser/MAK.
- Wagner, Manfred (1986): Mode verlangt nach Methodenvielfalt, in: Mode aus Wien. 1815–1938. Salzburg/Wien: Residenz, S. 7–8.
- Wagner, Sylvester (1844): Die Wäscherin, in: Stifter, Adalbert (Hg.): Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben. Pest: Gustav Heckenast, S. 214–218.
- Wagner, Sylvester [Zuschreibung unsicher] (1844): Der Ladendiener des Modehändlers, in: Stifter, Adalbert (Hg.): Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben. Pest: Gustav Heckenast, S. 1–9.
- Walther, Susanne (1976): Die Mode im Spiegelbild gesellschaftlicher Verhältnisse, in: 200 Jahre Mode in Wien. Aus den Modesammlungen des Historischen Museums der Stadt Wien, hg. vom Verein der Freunde der Hermesvilla. Wien: Eigenverlag der Freunde der Hermesvilla, S. 5–18.
Anmerkungen
Top of pageLiotard, Jean-Étienne: La Belle Chocolatière de Vienne [um 1743–1745], Pastell auf Pergament, 82,5 x 52,5 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Inv. Nr.: Gal.-Nr. P 161.
BackLiotard, Jean-Étienne: Portrait de Maria Antonia (Marie-Antoinette), Archiduchesse d’Autriche, future reine de France, une navette à la main [1762], Schwarzstift, Rötel, Bleistift, Aquarell auf feinem Vergé-Papier, 31,1 x 24,9 cm, Musée d'art et d'histoire, Genf, Inv. Nr.: 1947-0042.
BackRublack beschäftigt sich v.a. mit Stadtstaaten und Hansestädten, eröffnet aber auch auf Wien anwendbare Perspektiven.
BackDie Verbindung von Obsession und Ausdauer ist ein wesentlicher Zug Maria Theresias, etwa auch bei der Klärung der Frage, ob es Vampire wirklich gibt. Das Thema treibt sie von 1755 bis 1768 um.
BackVgl. das Protokoll des Kommerzienrats vom 31. Juli 1766, in dem sich der Wiener Handelsstand gegen die geplante Polizeiordnung wehrt (Maria Theresia 1893: 346).
BackMaria Theresias Vorliebe für Perlen lässt sich auch mit der Wiener Industrie für Kunstperlen decken.
BackSo entsetzt sie sich etwa in einem Brief vom 2. September 1776 über die Gerüchte, Marie-Antoinette habe durch den Kauf von Armbändern eine Staatsschuldenkrise ausgelöst und das Defizit mit weit unter Wert verkauften Diamanten ausgeglichen (vgl. Maria Theresia/Marie-Antoinette 1865: 174).
BackDarunter Liotard, den Marie-Antoinette erst nach mehrmaligem Drängen empfängt (vgl. Maria Theresia/Marie-Antoinette 1865: 11, 14) und ein Portrait nach Wien schickt, das Maria Theresia als „masse“ (in der Doppelbedeutung „Masserahmen“ und „unförmige Ansammlung“) (ebd.: 22) bezeichnet.
Back„Der Kurier, der in Ihrem Gefolge war, findet Sie groß und fett geworden. Wenn Sie mir nicht versichern würden, dass Sie ein Korsett tragen, so würde mich dieser Umstand beunruhigen, denn ich befürchte, dass Sie, wie man auf Deutsch sagt: auseinandergehen [...]. Die Windischgraetz [...] hat mir gestanden, dass Sie sich sehr vernachlässigen, sogar, was die Sauberkeit der Zähne betrifft; das ist ein genauso wichtiger Punkt wie die Taille, die sie auch noch übler gefunden hat [...]; sie hat auch hinzugefügt, dass Sie schlecht gekleidet sind. [...] Ich habe darüber nachgedacht, Ihnen, wenn Sie mir ein gutes Maß schicken wollten, hier Mieder oder Korsetts anfertigen zu lassen. Man sagt, dass die aus Paris zu fest sind; ich werde sie Ihnen per Kurier schicken. Liotard fährt eiligst nach Paris, um [...] mir [...] [ein Porträt] zu schicken.“ (Übers. FR)
BackPaul Christoph übersetzt „engraissé“ verharmlosend mit „zugenommen haben“. Das Wort „Engraissé“ bedeutet schlichtweg „fett geworden“ (vgl. Maria Theresia/Marie-Antoinette 2017: 27).
BackSo notiert eine Augenzeugin der Hochzeit am 16. Mai 1770: „The dauphine was very fine in diamonds. [...], the Corps of her Robe was too small & left quite a broad stripe of lacing & Shift quite visible, which had a bad effect between 2 broader stripes of Diamonds, She really had quite a Load of Jewells.“ (Percy 1926: 113f.)
BackKorsette bestehen – mit regional spezifischen Ausprägungen – bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts aus dicken Stoffen, Pappe, Stäben aus Fischbein, Weidenholz und anderen biegsamen Materialien.
BackNoch in rezenten Artikeln findet sich die Vorstellung, dass die Body Modification lediglich Ausdruck einer patriarchalen, die Frau in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkenden Geisteshaltung sei (vgl. u.a. Schillig 2015).
BackAnthropologische Erklärungen, das Korsett diene der Betonung sexueller Reize, gehen dem satirischen Topos der beinahe vollständig entblößten Brust auf den Leim. Während Illustrationen zur fehlenden Moralität von Frauen dieses Bild prägen, sieht die Praxis anders aus: Dekolletees werden ab dem 16. Jahrhundert durch hochgeschlossene Kleider oder Tücher ergänzt. Wichtig ist an dieser Stelle auch, dass das Korsett nicht auf Frauen beschränkt ist. Sieht man sich ein Portrait des jungen Franz Joseph an, sticht sofort die extrem schmale Taille ins Auge (vgl. Einsle, Anton: Kaiser Franz Joseph I. in der Galauniform eines österreichischen Feldmarschalls [1851], Öl auf Leinwand, 250 × 163 cm, Belvedere, Wien, Inv. Nr.: Lg 1625). Männerkorsette gehörten bis weit ins 19. Jahrhundert ausgerechnet zur Militärgarderobe und leben bis heute in versteiften Frackhemden und den Schulterpolstern von Sakkos weiter.
BackVgl. dazu etwa die Abbildungen im Journal des Luxus und der Moden vom März 1787 (Kupfertafel 8) und Mai 1787 (Kupfertafel 13) bzw. Juli 1787 (Kupfertafel 20), August 1787 (Kupfertafel 22) und September 1787 (Kupfertafel 25).
BackDas gilt nicht bloß für die schmalen Kleider des Empire, sondern bezeichnenderweise gerade für das Reformkleid der Wiener Werkstätten, das eine lange, schmale Silhouette anstrebt.
BackMelancholischer Ton und Akribie sind im gesamten Werk Stifters wesentliche Kompositionsprinzipien.
BackDasselbe Prinzip verfolgen Schnittmuster und Nähanleitungen, die nach den beiden Weltkriegen in Zeitschriften publiziert wurden, um alte Feldmäntel zu modischen Kostümen umzuarbeiten.
BackMit Ausnahme weniger Kleidungsstücke, die konkret an eine Person gebunden waren, wie etwa einer verhältnismäßig großen Sammlung von Kleidern von Kaiserin Elisabeth in verschiedenen Wiener Museen.
BackDasselbe gilt übrigens genauso für die Vorstellung einer kompletten Moderevolution im Zuge der Weltausstellung 1873.
Backvan Meytens, Martin (Zuschreibung unsicher): Maria Theresia in türkischem Kostüm [um 1744], Öl auf Leinwand, 97 x 76,5 cm, Schloss Schönbrunn, Wien, Inv. Nr.: SKB 001407.
BackWie sehr das „Fremde“ die europäischen Höfe beschäftigt, zeigt eine Gemäldesammlung, die in ihrem Bad Taste selbst aus der Perspektive der Cultural Appropriation unterhaltsam ist: In 56 Bildern lässt sich Sibylla Augusta, die Markgräfin von Baden-Baden, in verschiedenen Kostümen abbilden. Gesicht, Pose, Körper werden als copy-paste in die Serie eingefügt, lediglich die Staffage ändert sich. Besonders absurd ist die Verkleidung als Sklavin, mit einer an Armband und Kleidersaum befestigten Silberkette und einer Zipfelmütze, auf der sich diamantenbesetzte Maiglöckchen erheben. Vgl. Ivenet, Nicolas (Zuschreibung unsicher): Markgräfin Sibylla Augusta als Sklavin [um 1700–1710], Tempera auf Pergament, auf Holz aufgezogen, 28,3 x 20 cm, Staatliche Schlösser und Gärten, Karlsruhe, Inv. Nr.: G 8451).
BackAnonym: Weibliche Hutmoden und Frisur à l’Elefant [1793]. Kolorierter Kupferstich, Plattenmaß 17,5 x 9,5 cm, Wien Museum, Inv. Nr.: M 30086.
BackStaub, Andreas: Dlle PECHE. K. K. Hofschauspielerinn [1831], Lithografie, 49,4 x 32,1, Wien Museum, Inv. Nr.: W 5163.
Back„Natürlichkeit“, bei der immer vage bleibt, worin sie eigentlich besteht, wird als Erwartung ausschließlich an Frauen herangetragen. Männer hingegen bleibt die bürgerliche „Seriosität“ als politischen Subjekten vorbehalten. So kündigt das Blatt auf S. 7 die Option an, bei Bedarf auch Beilagen zur Männermode zu drucken. Dieser Zeitpunkt ist offenbar nie gekommen.
Back„So bleibt es doch immer die Aufgabe der Mode […], den Forderungen des Volkseigenthümlichen zu genügen, und überdies nicht phantastisch und durch Zwang unbequem und lästig zu werden.“ (Anonym (S.H.) 1816: 5)
BackAnonym: Pariser Ball-Anzug, in: Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode 33/2 (Februar 1818), Tafel 5.
BackZum Primat des Pariser Chic vgl. auch Wagner (Zuschreibung unsicher) (1844); und zu den Modeinformationen vor dem Erscheinen der Modezeitschriften vgl. Buxbaum 1986 43–49.
BackZu einem wirtschaftlichen Gender-Krieg vgl. die Geschichte der englischen Mantua-Makers in: Inder 2020; und zu den bereits unter Louis XIV gegründeten Schneiderinnenzünfte und deren Auswirkungen auf männerdominierte Organisationen vgl. Crowston 2000.
BackEin guter Ausgangspunkt ist etwa das Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich (1858): 17, in dem nicht nur die Hof-Modistin Theresia Geiger und die Hof-Posamentirerin Maria Tapfer, sondern auch eine Hof-Stuccaturmeisterin, Hof-Wappenmalerin, Hof-Buchhändlerin, Hof-Blasinstrumentenmacherin, Hof-Goldarbeiterin und Hof-Tischlerin aufgelistet werden.
BackWobei bisweilen außer Acht gelassen wird, dass die Mode des Ancien Régime sehr wohl streng gegendert war und aus heutiger Perspektive oft missverstanden wird (vgl. etwa Söll 2023).
BackSo als Beispiel unter vielen Walther 1976, die lediglich eine Entwicklung von Bart- und Hutmoden zeichnet.
BackDie wohl beste aktuelle Publikation zu einer anderen Perspektive auf Männermode in all ihren Elementen, vom Körper bis zur Kleidung, liefert der mit reichem Bildmaterial versehene Ausstellungskatalog des V&A (McKever/Wilcox 2022). Die Autor:innen konzentrieren sich auf England, bieten aber Folien, die sich auch auf Wien anwenden lassen.
BackVgl. Walther 1976: 11, die hier auf ein spezifisch wienerisches Phänomen hinweist, das in der übrigen Literatur nicht vorkommt.
BackSolche Erzählungen tauchen schon seit dem Aufkommen von aus dem Osmanischen Reich importierten, stark gemusterten Seidenstoffen auf, die den Mann des „Orients“ als grundsätzlich effeminiert betrachten und eine Übertragung in den Westen befürchten (vgl. dazu Kammel 2001). Bis heute wird – aus einer Außenperspektive, aber auch innerhalb der Queer Community – das Klischee des schwulen Mannes als eines lediglich an Spaß orientierten Objekts ohne politische Agenda aufrechterhalten.
BackJe nach zeitlicher und lokaler Ausprägung die Stutzer oder Incroyables. Eine außergewöhnliche Bildsammlung findet sich bei Vernet, Horace: Incroyables et Merveilleuses [um 1811-1814], Album mit 33 kolorierten Kupferstichen auf Papier, Blattmaß 42,2 x 28 cm, Albummaße 42,5 x 29,5 x 1,7 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, Inv. Nr.: 24.18.
Back