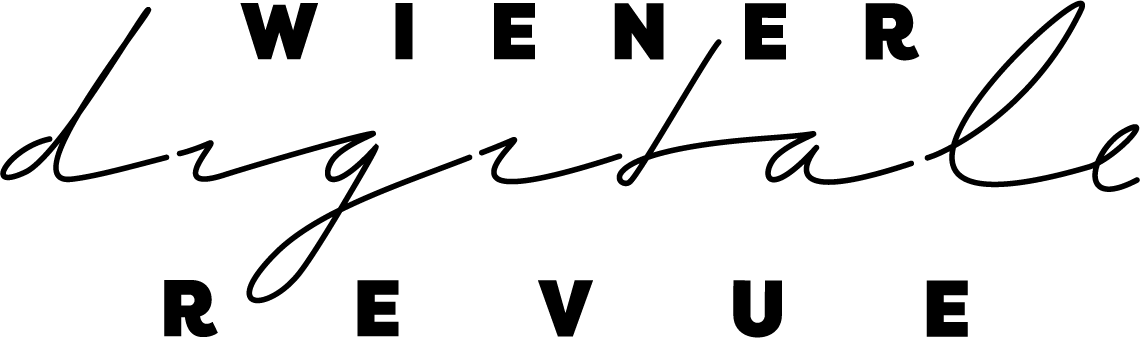
Zeitschrift für Germanistik und Gegenwart
Wolfgang Jacobsen
Sanft schwingend, jäh – doch zu früh
Bemerkungen zu Elfriede Jelineks Drehbuch Eine Partie DameLizenz:
For this publication, a Creative Commons Attribution 4.0 International
license has been granted by the author(s), who retain full
copyright.
Link
Wiener Digitale Revue 7 (2025)
www.univie.ac.at/wdrAbstract
Top of pageSchlagwörter
Top of pageSchlagwörter:
Volltext
Top of pageDieser Beitrag ist das erste Mal erschienen als Nachbemerkung zu: Elfriede Jelinek: Eine Partie Dame, hg. von Wolfgang Jacobsen und Helmutz Wietz. Berlin: Verbrecher Verlag 2018, S. 163–187.
„Ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Wenn Du noch Änderungen willst, dann sag es!“ Der Brief von Elfriede Jelinek in Wien an den Regisseur Rainer Boldt in Berlin trägt kein Datum, doch dürfte er im Dezember 1980 geschrieben worden sein. In Rede steht ihr Drehbuch Eine Partie Dame. Ein Originalstoff, keine Adaption einer ihrer Romane. „So wie es jetzt ist, muß man es unbedingt als Kino-Film anlegen, und zu sehr knausern sollte man auch nicht bei der Finanzierung.“ Das Vertrauen in das Projekt teilten Autorin, Regisseur und der Produzent Helmut Wietz. „Hoffentlich schaffen wir das!“
Elfriede Jelinek und Rainer Boldt hatten sich Ende der 1970er-Jahre in Wien kennengelernt. Sie hatte als Schriftstellerin mit den Romanen Die Liebhaberinnen, 1975 erschienen, und Die Ausgesperrten, fünf Jahre später, ihren literarischen Durchbruch erlebt. Das Schauspiel Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften war in der Inszenierung von Kurt Josef Schildknecht an den Vereinigten Bühnen Graz – im Rahmen des Steirischen Herbstes – im Oktober 1979 viel beachtet uraufgeführt worden, als Autorin von Hörspielen war sie schon länger etabliert. Ihr Interesse am Film war groß. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch, der sie in jenen Jahren vertrat, annoncierte nicht nur das Drehbuch Eine Partie Dame zur Verfilmung, sondern auch die Filmmanuskripte Die Ausgesperrten (nach ihrem Roman) und Clara S., von ihr weiterentwickelt zu dem Bühnenstück Clara S. musikalische Tragödie, im September 1982 von Hans Hollmann am Theater der Stadt Bonn uraufgeführt. Rainer Boldt, Jahrgang 1946 und im Juli 2017 gestorben, war Mitglied der Hamburger Filmmacher-Cooperative gewesen, hatte dann ein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) absolviert und war mit ersten Fernsehfilmen aufgefallen, darunter zwei Filmen in Koproduktion mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF), gedreht in Wien: Fehlschuß, 1977, nach einem Drehbuch von Herbert Brödl, mit Wolfgang Ambros, Franz Buchrieser und Pola Kinski attraktiv besetzt, erzählt von einer Aussiedlerfamilie in einem Industrieort bei Wien Ende der 1950er-Jahre, den Jungen bietet der Profifußball eine Aufstiegschance. Im Mittelpunkt des 1979 gedrehten Fernsehfilms Esch oder die Anarchie, einer Adaption des zweiten Teils der Romantrilogie Die Schlafwandler von Hermann Broch, steht ein Kleinbürger, der sich zu Unrecht entlassen sieht und orientierungslos in einer Welt agiert, die er als nur verquer und wider sich wahrnimmt. Hans Peter Korff spielt diesen „kleinen Mann“, der im Realen keine Erfüllung findet. Boldt kannte sich in Wien gut aus und war mit der Kostümbildnerin Barbara Bilabel befreundet, die ihm schon 1971 bei seinem dffb-Abschlussfilm Ach Viola assistiert und an den beiden Wiener Filmen mitgewirkt hatte. Beide verkehrten in Wiener Künstlerkreisen, einer, wie Helmut Wietz sagt, „überschaubaren kulturellen Community“. Zu dieser Gruppe gehörte auch der Regisseur Franz Novotny, der etwa zeitgleich mit der Entstehung des Filmprojekts Eine Partie Dame daran ging, die Verfilmung von Jelineks Roman Die Ausgesperrten vorzubereiten: Fallgeschichte einer Gruppe von Jugendlichen, auf authentischem Tatgeschehen im Wien der 1950er-Jahre basierend: Sie überfallen Passanten, bis sich die Gewalt ins Unermessliche steigert und einer der Jugendlichen in kaltem Rausch die eigene Familie metzelt. Wie wirkt die nationalsozialistische Deformation der Eltern auf deren Kinder? Das ist die Fragestellung. In der Figur der Sophie, einer kapriziösen Schönheit aus reichem Hause, finden sich Züge, die an Lisa, die Protagonistin von Eine Partie Dame, denken lassen. Vom Amok zu schweigen.
Zusammen mit Roland Hehn, Jahrgang 1939, Kommilitone an der dffb, der 1968 mit Klaus Wildenhahn den Dokumentarfilm Der Reifenschneider und seine Frau als Regisseur zeichnete, hatte Boldt 1969 faktisch ohne Eigenkapital die Common Film Produktion in Berlin gegründet. Nach dem Tod Hehns 1970 trat Helmut Wietz in die Firma ein, die aber erst sieben Jahre später mit Rüdiger Minows psychiatriekritischem Film Die Anstalt als Produktion aktiv wurde. Auch Wietz, geboren 1945, hatte an der dffb studiert und war 1973 mit Künstlerfilmen hervorgetreten – Performances 2 und Berlin-Übungen in neun Stücken mit der Aktionskünstlerin Rebecca Horn, Made in New York mit dem Maler Karl Horst Hödicke und mit Joseph Beuys I Like America …. Wietz erinnert sich, dass man Ende der 1970er-Jahre anfing, „verstärkt zu produzieren“ und sich an „riskantere Projekte“ traute. Riskanter, was die Stoffe anging, riskanter aber auch, was die finanziellen Ressourcen betraf. Eine Partie Dame war ein solches Vorhaben. Wietz selbst war zunächst nur am Rande in das Projekt involviert. Boldt brachte das Drehbuch in die Common Film ein, die Gespräche über die Entwicklung des Stoffes, über Änderungen und Akzentuierungen führten dieser und Elfriede Jelinek allein. Wietz war zu diesem Zeitpunkt in den USA, eingebunden in die „Vorbereitungen für das Montagefilmprojekt ‚Zwischen den Bildern‘ der Deutschen Kinemathek“. Bei seiner Rückkehr präsentierte Boldt das Drehbuch von Jelinek, schnell verständigten sie sich darauf, den Film drehen zu wollen.
Wien – im Grenzbereich zwischen Ost und West. Zwar nicht mehr die Stadt der Vier im Jeep, doch eingekeilt zwischen den politischen Blöcken, im Fadenkreuz von Kapitalismus und Kommunismus, und immer noch Treffpunkt der Emigration sowie Tummelplatz von Agenten. Hier begegnen sich Andzrej, polnischer Jude und Kommunist, Kopf eines Agentenrings, und die Studentin Lisa. Sie erliegt einer obsessiven Leidenschaft. Er nutzt den Sex als Augenblicksglück. Das ist ein Erzählstrang des Drehbuchs. Der andere ist geprägt von der besonderen Atmosphäre Wiens, jene, wie Jelinek vorgibt, der „Wurschtigkeit, des Laissez-faire und der allgemeinen Düsternis“, durch die einst wie von ungefähr Harry Lime seine Bahnen zog und seine trüben Geschäfte machte, und nun, Jahrzehnte später, Kuriere verschwiegen auf öffentlichem Transit westliche Technologie in den Osten schaffen: aus Geldgier die einen, andere aus moralischer Überzeugung. In ihrer Vorbemerkung zum Drehbuch betont die Autorin, wie wichtig es ihr ist, dass die „Relikte der alten Kultur der Monarchie“ kenntlich werden, ein Babylon der Sprachen, Markt von Lebensgefühlen, des Miteinander und der selbstbehauptenden Abgrenzung. Das Milieu der Emigranten, jener, die bleiben wollen und jener, die von Russland nach Israel wollen und Station machen in Wien, und der Kämpfer, die im Spanischen Bürgerkrieg waren, die für die Republik sich schlugen und nun wie Verschlagene in dieser Stadt überleben. Die Stimmung also schwermütig und schwarzseherisch, Hypochondrie, Melancholie und Depression Hand in Hand, Hoffnung auf eine bessere Welt, Leiden an der bestehenden, dies alles mit „großer Leichtigkeit gepaart“, mit „ironischer Distanzierung und Distanzierungsfähigkeit“, eben „Element, das typisch für den östlich-jüdischen Kulturkreis“ ist, alles in allem: „unverwechselbares Bild einer unverwechselbaren Stadt“, die „als einzige in Westeuropa noch nicht amerikanisiert ist“. Nicht nur die Story einer verrückten Leidenschaft, einer enttäuschten Liebe, eines Missverstehens aus Attraktion, sondern auch Studie einer politischen Situation, Porträts menschlicher Haltungen. Der Rhythmus des Ganzen eine „sanft schwingende Sinuskurve“, cool, und plötzlich von „jähen Action-Zacken gestört“. Fadenschmal die Grenze, die Liebe von Politik trennt, bewegtes Genre von schaler Konvention.
Die Story ist genau verortet – 1. Wiener Gemeindebezirk, Innere Stadt, erwähnt wird die Paniglgasse, ein Bordell an der Franzensbrücke in der Leopoldstadt, dem 2. Bezirk, nahe dem Prater, die Straßenbahnlinie O kreuzt die Brücke mit dem Ziel Praterstern, auch dies Spielorte. Andere Szenen ereignen sich in Hietzing, Grinzing und Kagran oder verweisen auf diese Gemeinden, im Traditionshotel Panhans am Semmering liegt das Liebesnest von Andzrej und Lisa. Szenerien außerhalb Wiens sind die Eisenbahn-Transitstrecke München-Berlin, deren Grenzstationen, die Bahnhöfe im Westen und Osten der geteilten Stadt. Jelinek spielt vielfach auf Aktualitäten an, Zeitkolorit prägt die Atmosphäre. Mediale Bilder und Töne legen sich wie ein Spinnennetz um die Geschichte. Die TV-Nachrichtensendung ZIB 1 des Österreichischen Rundfunks etwa findet Erwähnung, Kürzel für Zeit im Bild, in der Lisa Andzrej bei den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der DDR im Oktober 1979 zufällig sieht. Oder: Die beiläufige Erwähnung des Vornamens Simone in einem Dialog zwischen Andzrej und seinem Freund Ivan verweist auf die französische Politikerin und Shoah-Überlebende Simone Veil. Der Zufall wollte es, dass die politische Folie des Drehbuchs, Spionage für den sogenannten Ostblock, durch die Aufdeckung eines Agentenrings in Österreich 1980/81 Aktualität erhielt, dessen Mitglieder – Funktionäre aus Politik, Polizei und Ministerialbürokratie – für den rumänischen Geheimdienst „Securitate“ sich hatten einspannen lassen. Im Drehbuch geht es konkret um den Schmuggel von Elektronikbauteilen, sogenannten Magnetblasenspeichern, einer Art Computer-Datenspeicher, zu der Zeit der Dernier cri der Branche. Österreich genoss wegen seines Neutralitätsstatus den zweifelhaften Ruf, eine Agentendrehscheibe zu sein und war obendrein im internationalen Waffenhandel auffällig. Auch der Nimbus des Landes als Flüchtlingsidyll eine Legende: Mord, Verschleppung, Erpressung – wer die Freiheit suchte, konnte sich in Wien nicht sicher sein. Abgesehen davon, dass der 1979 verabschiedete Nato-Doppelbeschluss, ein Akt der Aufrüstung, die politische Haltung Andzrejs zusätzlich stabilisiert.
Eine erste Fassung des Drehbuchs, ohne Datum, ist gegenüber der zweiten vom 1. Februar 1981, in den Regieanweisungen detaillierter. Es gibt handschriftliche „Versäuberungen“ von Jelinek, Hinzufügungen und Streichungen von Boldt, noch ist die Form des Drehbuchs nicht gefunden, aufgebaut ist das erste Skript eher wie ein fließender Lesetext. Die Autorin neigt noch verstärkt zu interpretierenden Hinweisen, etwa heißt es in der Szene vor der ersten sexuellen Begegnung Lisas mit Andzrej in dem Lokal, das er als Tarnung für sein eigentliches Geschäft betreibt: „Es sieht für den Zuschauer wie der Beginn einer ausweglosen sexuellen Leidenschaft aus, was aber in der Folge denunziert wird.“ Oder an anderer Stelle, als Lisa hektisch durch das Bürogebäude stürmt, in dem sie Andzrej vermutet, und in einem Anwaltsbüro erscheint: „Lisa klingelt an der nächsten Tür, ein wenig wird es eine Reise durch die Männerwelt. (Diese Szene hat auch den Sinn, Sympathien für die manchmal recht unsympathische Hauptdarstellerin zu wecken.).“ Jelinek nutzt die Szene, um, wie es die Dramaturgin und Publizistin Ute Nyssen bezogen auf deren Theaterstücke darstellt, die „Masken bombastischen Männergehabes“ als „Affentheater dem Spott auszusetzen“. Doch bleibt trotz dieser dramaturgischen Hilfestellung von Lisa das Bild: allein bist du nur was zum Weinen. Auch fixiert Jelinek in der ersten Drehbuchfassung ihre Vorstellungen, wie was zu inszenieren sei, recht genau. Von Boldt werden diese Passagen weitgehend gestrichen, etwa eine Regieanweisung für die Szene im Naturkundemuseum zwischen dem Studenten Klaus und Lisa. „Starre Kamera ist gleich der Fixpunkt des Voyeurs, der sie beobachtet. Der Ton verliert die beiden gleichzeitig mit der Kamera, und dann tauchen sie wieder auf.“ Jelinek schreibt mit Einstellungen vor Augen. Denkt filmisch, sucht beim Schreiben schon nach szenischen Auflösungen. Sehr viel knapper ist der Schluss der ersten Fassung, der mit Lisas Mord, einer Tat irisierender Brutalität, endet. Der Showdown der Agenten fehlt ganz.
In einem Gespräch mit dem Schriftsteller und Kritiker Peter von Becker gesteht Elfriede Jelinek, sie sei, bezogen auf das Theater, „fasziniert von der Idee des Ortes, wo man Sprache und Figuren öffentlich ausstellen kann. Wo Sprache und Figuren, ähnlich wie schon beim antiken Theater, diese Übergröße in der Präsenz bekommen können, die sie im Film nicht haben. Im Film kann man zwar durch künstliche Sprache und Stilisierung arbeiten wie zum Beispiel Jean-Marie Straub; aber das ist dann schon wieder abgestempelt als ‚experimentell‘. Nur das Theater wäre der Ort der allergrößten Wirklichkeit und der allergrößten Künstlichkeit.“ Das Interview wurde 1992 geführt, anlässlich der Uraufführung ihres Stückes Totenauberg. Ihr Drehbuch Eine Partie Dame zeigt keine Verwandtschaft zu Straub; „experimentell“ ist es gleichwohl, weil sie es riskiert, Genrekonventionen zu vermischen. In der Zuspitzung, mit der sie dies tut, hebt sie sich deutlich ab von den ästhetischen Erscheinungsformen des bundesdeutschen (Autoren-)Films der Zeit. Vor allem Sprache ist – jenseits des erzählerischen Weges, der Handlungsführung, der dramaturgischen Narration – das „Leitmedium“ ihres Filmentwurfs: wie miteinander gesprochen wird, wie aneinander vorbei, in welcher Sprache, welcher dialektalen Färbung. Dialekt, dessen Gefälligkeit, Weichheit täuscht, ist verwendet als ein Mittel des Realismus. Wenn Lisa ins Wienerische fällt, dann schauspielert sie. Säuselt emotionale Fake news. Im rhetorischen Ausdruck allein schon offenbaren sich die Protagonisten, das Gestische tritt zurück. Wie auch immer Rainer Boldt diese Vorgabe szenisch umgesetzt hätte. Jelinek bedenkt die politischen Bedingungen sprachlicher Handlungsfähigkeit. Das Unheil ist genau. Das gilt auch für eine unsympathische Unschuldsfigur wie Lisa. „Sie sprechen sogar das, was sonst nicht gesprochen wird, auch noch aus. Der Subtext wird mitgesprochen.“ So Jelinek zu Peter von Becker. Die Komponistin Olga Neuwirth, mit der Schriftstellerin gut bekannt und mit deren Werk vertraut, befindet, sie fasziniere „der distanzierte Blick ohne Mitleid auf Menschen und Dinge, die Schärfe der Sprache, der entlarvende Einsatz von sprachlichen Zitaten aus der Alltagswelt sowie die ironische Kälte und der böse Blick des Satirikers, der wie ein Wissenschaftler die Umgebung beobachtet“. Auch wenn Jelinek im Gespräch mit von Becker sagt, sie habe eher „ein misanthropisches Weltbild“, wider die Menschen ist es nicht. Die Zeichnung ihrer Figuren ist wahrhaftig. Wirklichkeit und Künstlichkeit sind – auch in diesem Drehbuch – kein Widerspruch, eher Bedingung für die erzählerische Verve: denn Künstlichkeit ist Wirklichkeit.
Ende November 1980 schloss Helmut Wietz für die Common Film mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch einen Options- und Verfilmungsvertrag (für die Weltverfilmungsrechte) an dem Stoff, der bis zum 31. März 1981 gelten sollte. Dem waren Verhandlungen über das Autorenhonorar vorangegangen. Doch lange zuvor, schon am 6. März 1980, hatte Jürgen Bansemer, der mit Ute Nyssen für den Verlag die Rechte Jelineks vertrat, ein „neues Rohdrehbuch“ an Rainer Boldt geschickt und warb: „Sie ist ja eine tolle Autorin, und da sie so stark zum Film drängt, hat sie auch Erfolg. Jetzt produziert sie ein anderes Drehbuch ganz frei, mit einer riesigen Prämie des österreichischen Staates und Abschreibungsgeldern.“ Womit Die Ausgesperrten gemeint ist. „Außerdem schließen wir gerade für sie mit dem WDR ab über einen ‚Clara-Schumann- Film‘. Daß ich Ihnen das Drehbuch vorlege, habe ich mit der Elfriede abgesprochen. Sie kennt einige Ihrer Filme und fand sie sehr gut.“ In der Folge – also weit vor der Unterzeichnung des Vertrags – kam es zwischen Jelinek und Boldt zu gemeinsamer intensiver Arbeit am Drehbuch. Brieflich bat Boldt am 29. August, sie möge einige Änderungen vornehmen, damit „unsere kleine Firma“ den Film machen kann. Er wünschte Eingriffe in drei Punkten: „Ausbau von Andzrejs Spionagetätigkeit, Charakterisierung des Klaus und ein etwas breiter (ausführlicher, spannender) angelegtes Ende“. Auch ging es zwischen beiden bereits um Fragen der Finanzierung, noch gab es die Option einer deutsch-österreichischen Koproduktion. Boldt riet in seinem Schreiben vom August zur Zurückhaltung, das Drehbuch bereits österreichischen Produzenten anzubieten, solange keine Klarheit über die Beteiligung von deutscher Seite herrsche. Zudem fürchtete er, dass sich eine Antragstellung „tatsächlich mit den ‚Ausgesperrten‘ überschneiden könnte“.
Zunächst begab man sich bei der Common Film auf die Suche nach deutschem Fernsehgeld. „Ja, das sollte in jedem Fall in Koproduktion mit dem Fernsehen gemacht werden, dem Fernsehspiel im ORF, zunächst, und da hatte er ja auch schon Kontakte und ist davon ausgegangen, dass wegen Jelinek und ihm auch Interesse an dem Stoff bestünde, das haben sie auch bekundet, doch das hat zunächst mal zu nichts geführt, weil der ORF nicht der Hauptfinanzier des Films gewesen wäre.“ So Helmut Wietz. Dann kamen die bundesdeutschen Fernsehanstalten ins Spiel. „Das ist ja diese Finanzierung gewesen, wie sie heute nicht mehr in der Form betrieben wird, mit der Folge, dass die meisten deutschen Kinofilme wie Fernsehfilme aussehen, weil man ohne das Fernsehen keine Filmförderung kriegte und umgekehrt genauso.“ Zu werten als ein kritisch reflektierender Blick retrospektiv, in der Gegenwart des Projekts und seiner Entwicklung war die finanzielle Beteiligung eines Senders der ARD oder des ZDF der hoffnungsvolle Garant, um den Film überhaupt finanziell zu stemmen. Kalkuliert war der Film auf 1,5 Millionen Mark, eine beträchtliche Summe für die damalige Zeit, geschuldet wesentlich dem Umstand, dass ein Kinofilm entstehen sollte, erst die Zweitausstrahlung für das Fernsehen vorgesehen war. Der Finanzierungsplan, erstellt am 1. Dezember 1980, sah eine Beteiligung von Seiten einer Fernsehanstalt in Höhe von 600.000 DM vor, bei einem Eigenanteil der Common von gut 150.000 DM (zusammengesetzt aus Eigenkapital, Rückstellung von Teilen der Regie- und Herstellungsgage und technischen, geldwerten Eigenleistungen, also für Schneidetisch, Tonausrüstung, Beleuchtungstechnik und Tonumspielung). Weiterhin rechnete man mit einem sogenannten Konsortialkredit für Berlinförderung in Höhe von 300.000 DM, einer Produktionsförderung durch die bundesdeutsche Filmförderungsanstalt von 350.000 DM, einer Projektförderung von 100.000 DM durch das Kuratorium junger deutscher Film. Die Kalkulation ging von optimistischen Prämissen aus und barg ein – dem Produzenten nicht fremdes – Vabanque. Beim „Kuratorium hätten wir gar nicht beantragen dürfen, weil die nur Erstlingsfilme fördern, und der Rainer Boldt hatte schon eine Förderung mit dem Kinderfilm ‚Ich hatte einen Traum‘ bekommen. Da haben wir nur darauf spekuliert.“ Erinnert sich Wietz. So schickte dann auch das Kuratorium junger deutscher Film bereits am 23. Dezember 1980 die Unterlagen an die Common zurück, mit dem knappen Beschied, man handhabe zwar zuweilen die Statuten nicht so starr, aber Boldt habe schon diverse Förderungen erhalten. Derweil verzögerte sich die Behandlung des Antrags bei der Filmförderungsanstalt, Anfang März 1981 zog die Common zunächst den Projektantrag zurück, wohl, weil die Verhandlungen mit den Fernsehanstalten, die ja den finanziellen Sockel stellen sollten, wenig aussichtsreich verliefen. Schließlich kam am 16. Juni 1981 auch die Absage, dass der Ausschuss, der über das Projekt für eine Filmförderung durch das Bundesinnenministerium zu befinden hatte, „‚Eine Partie Dame‘ nicht in die Förderungsmaßnahmen einbezogen“ habe, da man „bei der Bewertung der künstlerischen Qualität […] und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel [… ] andere Projekte zur Förderung vorgeschlagen hat“. Folgte der bürokratisch und juristisch korrekte Verweis auf die entsprechenden Paragrafen des Filmförderungsgesetzes. Helmut Wietz rekapituliert den Sachverhalt: „Die Filmförderungsanstalt hätte sich nur dafür entschieden, wenn wir den Fernsehanteil nachgewiesen hätten, die Zusage, dass wir 600.000.— vom WDR oder wem auch immer bekommen. Und das ist ja leider nicht zustande gekommen. Weil, das hat dann ja so einen Dominoeffekt in positiver wie in negativer Hinsicht: wenn einmal nicht, dann kriegste alle Absagen. Und wir waren natürlich schwer enttäuscht, weil wir gedacht haben, das ist ein toller Stoff.“
Doch das Fernsehen hat seine eigenen Gesetze, eigensinnige Redakteure und Budgets, die üppig aber nicht unbeschränkt sind. Keine der ARD-Anstalten, auch nicht das ZDF war bereit, sich für das Projekt zu engagieren. Nicht der Westdeutsche, nicht der Norddeutsche, nicht der Saarländische Rundfunk, auch nicht der Sender Freies Berlin. Nahezu alle angesprochenen Redakteure – Joachim von Mengershausen, Gunter Witte, Martin Wiebel, Dieter Meichsner, Eberhard Scharfenberg, Ulrich Nagel – formulierten Vorbehalte inhaltlicher Art – oder aber es waren die verfügbaren Gelder schon anders verplant. Boldt litt vor allem unter der Absage des ZDF, auf dessen Beteiligung die Common Film große Hoffnungen gesetzt hatte, zumal Wolfgang Ainberger vom ORF bereit gewesen wäre, bei einer ZDF-Beteiligung ebenfalls in das Projekt einzusteigen. Die ablehnende Haltung kam vor allem von Heinz Ungureit, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehspiel und Film, der, so lässt ein Brief von Boldt an Franz Novotny vom 23. Juli 1981 erkennen, monierte, das Drehbuch erinnere ihn mehr an „Hörspiel und Literatur“. Boldt hoffte, diese Haltung durch Änderungen, für die er Vorschläge der ZDF-Redaktion erwartete, abbiegen zu können. Zwar hatte Werner Kließ, ehemaliger Redakteur der Zeitschrift „Film“ (Velber) und zu der Zeit beim ZDF unter anderem verantwortlicher Redakteur für Serien wie Der Alte, Derrick und Ein Fall für zwei, sich für das Drehbuch Eine Partie Dame eingesetzt, aber er war nicht direkt zuständig. Boldt dankte ihm brieflich am 29. April 1981 für den Einsatz, der „Auftrieb“ gebe, und schildert, dass er mit Elfriede Jelinek über Änderungen gesprochen habe, „die derzeit in der Mache sind: das Interpretatorische in der Beschreibung Lisas streichen, Lisa witziger und geistreicher gestalten, die Mutter größer, schöner, großbürgerlicher machen, zur Konkurrentin der Tochter erheben, ebenfalls den Klaus aufwerten, einen attraktiven Mann aus ihm machen, dem Lisa sich zu seiner Verzweiflung entzieht; irgendwann in der Geschichte Lisa einmal souverän gegenüber Andzrej sein lassen, Macht über ihn haben, in die er sich sogar fügen will! All dies hier nur angerissen.“ Er erwartete, dass Ungureit Kließ darauf ansprechen werde und munitionierte so den Befürworter. Denn am gleichen Tag wandte sich Boldt auch an Ungureit, der nach längerer Abwesenheit zurück in der Redaktion war, und erinnerte ihn an eine alte Verabredung, doch etwas gemeinsam machen zu wollen, nachdem bereits ein früheres Projekt nicht als Koproduktion zustande gekommen war. Ungureit hatte damals ein „einfacher ausgestattetes Filmprojekt“ empfohlen. „Das hat bei mir Zeit gebraucht“, so Boldt, „und schließlich haben Elfriede Jelinek und ich aus den Beobachtungen unserer jeweiligen Arbeiten heraus, ein solches Projekt entwickelt; recht gewöhnlich im Aufwand, aber doch anspruchsvoll im Sinne unserer gegenwärtigen Erwartungen.“ Deshalb sei er enttäuscht, dass das ZDF bei seiner ablehnenden Haltung bleiben wolle. Und verweist auf die Befürwortung von Kließ, auch wenn der Änderungswünsche angedeutet hatte. Über die Gründe der Reserviertheit kann man nur spekulieren, doch scheint der – auch sprachlich – eigenwillige Versuch Jelineks, aus einer subjektiven, aber eben nicht gleichsam offiziellen feministischen Position heraus, eine eminent politisch grundierte und dennoch individuelle psychologische Studie zu schreiben, Misstrauen erregt zu haben. Das Drehbuch leistet sich eine Versuchsanordnung, die mit erzählerischer Konvention bricht. Es ist eine zeitversetzte und in sich paradoxe optimistische Tragödie. Auch eine tragische Komödie.
Allein Hans Kwiet aus der Redaktion Fernsehspiel, Hörspiel und Feature beim Sender Freies Berlin konnte neben Kließ dem Drehbuch etwas abgewinnen. An Boldt schrieb er bereits am 14. November 1980, dass das Projekt zwar vom SFB nicht realisiert werden könne, da man sich entschlossen habe, einen Film von Margarethe von Trotta zu unterstützen – gemeint ist Die bleierne Zeit, Trottas Versuch, sich aus und mit Betroffenheit über eine Schwesterbeziehung dem politischen Terrorismus zu stellen –, doch sei er überzeugt, dass trotz „der Bedenken und Einwände, die von denen, die den Stoff von Frau Jelinek kennen, immer wieder dagegen vorgebracht“ wurden, es „sicher ein sehenswerter Film wird, wenn Sie ihn inszenieren“. Doch mahnte er, das Wohlwollen schmälernd, „das vorliegende Buch einer genauen Prüfung“ zu unterziehen, „um Fehlinterpretationen und Ungenauigkeiten auszuschalten, um ihre Auffassungen und Absichten dabei zu verdeutlichen“. Vorgelegen haben muss Kwiet also nicht die endgültige Fassung von 1981, sondern möglicherweise eine Version zwischen erstem Entwurf und dem endgültigen Drehbuch. Dabei verwies Kwiet auf ein Gutachten des Lektors Mario Krebs, heute Produzent der Eikon Film, das dieser im Oktober 1980 abgefasst hatte, einziges überliefertes schriftliches Dokument, aus dem sich – pars pro toto – die redaktionellen Einwände auch anderer andeutungsweise ableiten lassen. Krebs summiert, dass es sich wesentlich um „eine psychologische Studie über eine exzessive Beziehung zweier Menschen“ handle: „Allein die Sexualität – auch unterschiedlich erlebt – hält sie zusammen.“ Ihm gefällt diese Konzentration auf „das Aufeinandertreffen einer jungen Studentin und eines erfahrenen älteren Mannes“. Und er befindet, dass Jelinek diese beiden Protagonisten „mit Sympathie“ zeichne – „Sympathie sowohl für den Mann (obwohl er das Mädchen emotional und sexuell rigide ausbeutet) als auch für das Opfer (auch wenn sie die bedingte Eigenverantwortlichkeit Lisas für ihre Lage herausstellt)“. Zwar verkürzt seine Bewertung den sehr viel komplizierteren Konflikt, der zwischen Andzrej und Lisa ausgetragen wird, doch immerhin, so gibt er zu, sei sein Interesse an der Geschichte geweckt. Aber mit dem politischen Hintergrund, der Agentengeschichte, vermochte er nichts anzufangen. Und vermutet, dass dieser dem Zuschauer auch den Blick auf Andzrej verstellen könnte. Jelineks politische Implikationen entgehen ihm. Wozu der „Agenten-Background“? Er mutmaßt: „Weil eine extreme Beziehung auch eine Ausnahmesituation braucht? Während der Schilderung der Beziehung Lisa-Andzrej fällt die Spionagegeschichte völlig in den Hintergrund, bleibt ohne Einfluß. Auch als Lisa ihm auf die Spur kommt, Andzrej verhaftet wird und wieder frei kommt, bleibt das für mich (merkwürdig) außerhalb der eigentlichen Geschichte, ebenfalls ohne Einfluß. Oder soll die Agentenstory den erfahrenen Mann in seiner Erfahrung und Unerreichbarkeit gegenüber der unbedarften Studentin aufwerten? Ich habe die Differenz zwischen beiden Figuren auch so begriffen.“ Krebs entgeht, dass die „psychologische Studie“ die politische Folie Wiens, die Differenz der Lebenshaltungen, ebenso das Konklave des Emigrantenzirkels als dramaturgisches Triebmittel braucht. Jelinek erzählt eben nicht nur von einer Amour fou, sondern in dieser liebessexuellen Passion zweier Menschen wird über Lebenshaltungen nachgedacht. Und über gesellschaftliche Haltungen. Auch die politische Indifferenz, ja, Naivität Lisas ist politisch. Und Andzrejs Agieren ist nicht pekuniär motiviert, sondern persönlich grundiert. Er ist ein polnischer Jude, Andzrej Weintraub, seine Eltern, so wird in einem Dialog angedeutet, sind im Gas von Auschwitz ermordet worden. Was er tut, tut er aus Überzeugung, weil er das „Krematorium der Neutronenbombe“ verhindern will. Da ist Andzrejs selbstbewusste Impertinenz, mit der er auf seinem Leben beharrt. Doch Leidenschaft kann auch deformieren, selbst lässig gehandhabte. Wenn es keine Lücken mehr im System gibt, dem selbstverfertigten und lieber gehabten als dem Liebgehabten, bleibt als letzter Ausweg nur die Negation. Lisa, ungeübt in der Sinnlosigkeit des Glücks, läuft Amok, tobt im Absoluten, hingegeben dem Real thing. Eine individuelle Tat einerseits, andererseits eine politische Emotion. Und filmisch unterstrichen durch den wie comichaft gedachten Showdown, der – Slow motion – ins Weltwüste driftet. In Krebs’ Gutachten lassen sich verkürzt die Einwände entdecken, die der Akzeptanz des Drehbuchs widersprachen. Auch sein Schlusssatz verdeutlicht, woran Eine Partie Dame auch in den Gremien der Förderinstitutionen und Redaktionen der Sender scheiterte: „Ob das nun ‚Kino‘ ist, vermag ich nicht zu sagen. Die Kriterien darüber sind m.E. in den zuständigen Förderungsgremien viel zu ungeklärt.“ Zugespitzt: Das eigentlich wohlwollende Gutachten beinhaltete das Schachmatt für Eine Partie Dame.
Früh war die Frage, wer welche Rolle im Film spielen sollte, Gegenstand gemeinsamen Nachdenkens. Autorin, Regisseur und Produzent stellten sich eine internationale Besetzung vor. Jelinek dachte gar an amerikanische Stars. An Boldt schrieb sie ohne Datum, wohl Ende 1980: „In jedem Fall glaube ich, daß wir, falls wir Cassavetes oder Gazarra nicht kriegen (was leider sehr wahrscheinlich ist), dennoch einen Amerikaner für den A. nehmen sollen und müssen.“ John Cassavetes, dessen Regiefilme von höchstem Gefühls(aus)druck leben und der auch als Schauspieler spontan und gefühlsbetont auftrat, bis hin zum kühlen Unterspielen der Emotion, wäre gewiss eine ideale Besetzung gewesen, ebenso wie Ben Gazzara, zu Cassavetes’ ‚Familie‘ gehörend, auch er lässig, ironisch gebrochen und mit zupackender Verletzlichkeit ausgestattet. „Auf keinen Fall darf es ein Deutscher oder Österreicher sein“, postulierte Jelinek. „Da bin ich ganz dagegen. Er ist die einzige Figur, die sich vollkommen locker und selbstverständlich bewegt, und das haben die Deutschen noch nie gekonnt, das kann selbst ein drittklassiger Ami noch besser.“ Einem solchen Wunsch zu entsprechen, überforderte die Produktion. Dazu Wietz: „Wenn man Cassavetes angesprochen hätte, dann hätte man auch noch andere Produzenten haben müssen, da wären wir überfordert gewesen zu dem Zeitpunkt.“ Aber international zu besetzen, daran gab es kein Deuteln. Jelinek ergänzte: „Eventuell noch ein Italiener. Kein Franzose.“ Sie hatte genaue Vorstellungen von der Körperlichkeit ihres Hauptdarstellers. Doch schließlich einigte man sich doch auf einen französischen Schauspieler: Serge Gainsbourg. „Das war ein Vorschlag von Rainer und mir“, erinnert sich Wietz, der Boldt zutraute, den Film à la Melville zu inszenieren. „Wir haben das mal so durchdekliniert. Jelinek hatte wohl eher so die Vorstellung – ein Amerikaner in Wien. Wie bei der ‚Dritte Mann‘. Und mit einer Neigung zu etwas Düsterem, nur mal so als Ton. Und Rainer hatte da mehr so Melville im Blick, dieses Agentenklima, wobei ja Melville auch mit amerikanischen Autos und so hantiert, aber es sind alles französische Schauspieler, wunderbar.“ Da Yves Montand wegen seines Alters nicht mehr in Frage kam und sicher auch nicht zugesagt hätte, suchte man eine Alternative. „Elfriede war mal in Berlin, da haben wir uns zusammengesetzt, wir waren uns dann schnell einig. Und wenn man sich heute mal überlegt, wie ihre Stoffe jetzt in Frankreich ankommen, also auch Michael Hanekes Verfilmung von ‚Die Klavierspielerin‘ – Frankreich-Wien – da war das eine logische kulturelle Ergänzung.“ Gainsbourg hatte das gewisse Etwas – geschmeidig bis zur Anstößigkeit und doch von zarter Schüchternheit. Als Chansonnier berühmt, doch „singen durfte er in unserem Film nicht“, als Filmschauspieler eher ein No name. Am 22. Dezember 1980 nahm die Common Film brieflich Kontakt mit dem Agenten Gainsbourgs in Paris auf, stellte das Projekt vor, legte eine Skizze des Plots bei, die Übersetzung des Drehbuchs ins Französische war noch nicht abgeschlossen, annoncierte einen Drehbeginn für August/September 1981 und hoffte, dass Gainsbourg sich für den Stoff würde begeistern können, „whether there is an interest and a chance of having him for this tremendously important part“. Am 10. März 1981 antwortete der Agent, Gainsbourg sei sehr angetan. Ein Treffen mit ihm in Paris wurde für den 14. April verabredet. Wietz über das Treffen: „Wir sprachen kein Französisch, Gainsbourg kaum Englisch, nur gebrochen. Übersetzt hat Bernhard Frey, ein Freund Boldts, Autor und zuweilen auch dessen Regieassistent. Das war sehr lustig. Wir haben ihn in seinem schwarzen Loch besucht: Rue de Verneuil 5 bis im 7. Arrondissement. Seine Wohnung – alles war schwarz gestrichen, auch der Flügel war schwarz. Das war so eine Ladenwohnung, nicht riesig, mehr so als Atelier eingerichtet, Parterre, ein Innenhof.“ Es kam zu einer Verabredung, Gainsbourg wollte die Rolle übernehmen, doch noch zu keinem Vertrag, denn die endgültige Finanzierung stand noch aus. Am 7. Juli des Jahres bat Wietz den Schauspieler um Geduld, man halte an ihm fest, doch werde man erst Ende November neue Termine absprechen können. Was sich zerschlug.
Mehr Kopfzerbrechen bereitete die Besetzung der Lisa. Sie sollte, so die Vorgaben der Autorin und der Produktion, höchstens 21 Jahre alt sein, zumindest so jung wirken, möglichst blond sein, oder brünett – ein heller Typ. Eine Schauspielerin, die nicht unbedingt viel Erfahrung mitbringen müsste, aber eine starke Ausstrahlung haben sollte. Jelinek machte in einem erneut undatierten Brief Vorschläge, vor allem dachte sie an Kristina van Eyck. Ein Test mit ihr könnte sich lohnen. Boldt hatte im Dezember für sich eine einseitige Skizze über Lisa verfasst, die dem biografischen Hintergrund der Figur Kontur gab, was so im Drehbuch nicht ausgeführt ist. „Anfang 1960 in Wien geboren“, der Vater Diplomat, „unter mysteriösen Umständen in Zentralafrika“ gestorben. Die Mutter „als Übersetzerin in einem wissenschaftlichen Verlag tätig“, „souverän, vernünftig, bescheiden“. Lisa „spürt die Bevormundung, haßt intuitiv den Zugriff auf ihre Persönlichkeit und kommt dennoch nicht los von der Beziehung zur Mutter.“ Das Drehbuch berücksichtigt dieses Verhältnis, der Vater aber ist schlicht perdu. Lisa – eine junge Frau, „klug und gebildet“, die um ihre „Schönheit“ weiß. „Es scheint, als sei das Erwachsen-Sein aus heiterem Himmel über ein junges Mädchen hergefallen, das nun versucht, mit dieser Rolle identisch zu werden.“ Der Text enthält auch eine Passage, die in der Beschreibung von Lisas Aussehen eine erstaunliche Ähnlichkeit zu Kristina van Eyck selbst hat: hoch gewachsen, im Rollentypus eher nervös gespannt und von lasziver Erotik: „Lisa ist groß. Größer als andere Frauen. Blond und kann eine kalte ätherische, hypersensible Ausstrahlung haben, wirkt aber durch die Größe und Schönheit ihres Körpers eher robust. Sie versteht es ganz vorzüglich, um sich herum eine Aura von Unnahbarkeit zu errichten. Sie kalkuliert ihre Anziehungskraft und spielt mit ihr, überschreitet jedoch niemals die gewisse Grenze von Leidenschaft und Berührung.“ Van Eyck stieß aber auf Widerstand des Produzenten Wietz. Schließlich, Ende Dezember 1980, äußerte auch Jelinek Zweifel und schlug Boldt Antonia Reininghaus vor, die schon bei der Grazer Aufführung von Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften in einer Nebenrolle mitgewirkt hatte und als „österreichische Garbo“ gefeiert worden war. „Sie ist Österreicherin, schön und hat ziemlich Ausstrahlung. Da sie aus der Großbourgeoisie kommt, hat sie eben diese Selbstverständlichkeit drauf.“ Einem Vorschlag Boldts, die Lisa mit Pola Kinski zu besetzen, mochte sie nicht folgen, die „ist viel zu keß“. Auch Wietz stand dieser Überlegung eher reserviert gegenüber. Dann kam durch die Vermittlung Cynthia Beatts, als Darstellerin, Autorin und Regisseurin in Berlin tätig, Tilda Swinton ins Spiel, zu der Zeit in Deutschland nahezu unbekannt, die allen als geeignet erschien. Wietz besuchte sie in London, wo Swinton Theater spielte, und konnte sie für die Rolle interessieren: „Tilda, ganz jung, supercool, englisch und dieses Unterkühlte hat ja auch eine gewisse Erotik“. Und auf diese sexuelle Attraktion kam es eben stark an.
Doch scheiterte das Projekt Eine Partie Dame deplorabel: ausschließlich am fehlenden Geld. Die Option verfiel, das Drehbuch verschwand in der Schublade. Der Versuch einer Reanimation als Fernsehfilm, 1983/84 betrieben, zerschlug sich ebenfalls. Nun hätten Hagen Müller-Stahl und Marie Colbin die Hauptrollen spielen sollen. Aber der Stoff war für die große Leinwand gedacht, nicht fürs Fernsehen entwickelt. Eigentlich, so Helmut Wietz in der Rückschau, stand nie wirklich zur Debatte, das Buch im Hinblick auf eine Redaktion zu überarbeiten und deren Wünschen anzupassen. „Wir fanden, es muss so sein, wie es ist.“ Kompromisse waren zu finden, klar, doch „das Problem ist,wenn man zu früh damit anfängt, bleibt zum Schluss nichts übrig“. Alles schien in so guter Bahn zu laufen, es gab einen Grundoptimismus bei der Vorbereitung, Kamera hätte übrigens Xaver Schwarzenberger führen sollen, der mit Boldt schon zuvor gearbeitet hatte. „Wenn der den Film fotografiert hätte, dann hätte der Film auch optisch eine Stimmung bekommen, die das unterliegende Sinistre des Stoffes, Teil der Atmo von Wien, gut herausgebracht hätte.“ Denn: „Ein Drehbuch ist eine Spielvorlage, das ist noch nicht der Film. Da kommt der Regisseur dazu, die Schauspieler, all die anderen Mitarbeiter, Kamera, da kommt der Schnitt, da verändert sich der Film noch einmal wesentlich, dann kommt die Musik hinzu, dann ist das ein ganz anderes Ding – als das, was ursprünglich beurteilt werden sollte.“
Eine Partie Dame ist Spielvorlage geblieben. Weil, resümiert Helmut Wietz, „es war vielleicht ein Stück zu früh“.
Notiz
Die Äußerungen von Helmut Wietz sind einem Gespräch mit dem Autor entnommen, das am 27. Juli 2017 in Berlin geführt wurde. Alle weiteren Zitierungen erfolgen nach den Produktionsunterlagen zu Eine Partie Dame. Außer:
- „Wir leben auf einem Berg von Leichen und Schmerz“. Gespräch mit Elfriede Jelinek. Von Peter von Becker, in: Theater heute 9, September 1992.
- Nyssen, Ute (2004): Nachwort, in: Elfriede Jelinek: Theaterstücke, hg. v. Regine Friedrich. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Jelinek, Elfriede/Neuwirth, Olga: ach, stimme. Interdisziplinäres Wissenschaftsportal des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. Abgerufen von: http://ach-stimme.com/?p=322, Zugriff am: 8.11.2017; das Wissenschaftsportal ist aktuell erreichbar unter https://jelinek-ach-stimme.univie.ac.at/, Zugriff am: 20.08.2025.