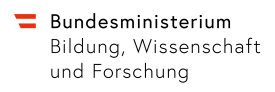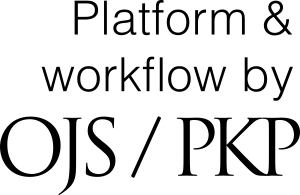Call 2/2025: Ideologiekritik und Medienpädagogik
MEDIENIMPULSE Call 02/2025
Ideologiekritik und Medienpädagogik
Alessandro Barberi
Christian Swertz
Seit den Gründungstagen der Medienpädagogik ist das reflexive Konzept der Kritik – nicht zuletzt als Medien*Kritik – in die Begriffe, Diskurse und Institutionen der Disziplin eingelassen (vgl. Wilde et al. 2025). So wurde die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant oder die Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx bereits in den 1970er-Jahren im Rahmen der Kritischen Medientheorien (Baacke 1974) deutlich rezipiert. Auch im Alltag sprechen viele Menschen von Selbstkritik, Kapitalismuskritik, Handlungskritik, Gesellschaftskritik, Sprachkritik bzw. Zeitkritik oder bezeichnen etwas als „unter jeder Kritik“.
Als Kritik wird – systematisch geordnet – damit dreierlei bezeichnet: Die Reflexion des eigenen Denkens als Erkenntniskritik, die Reflexion des Denkens Anderer als intersubjektive Kritik und die Reflexion von Institutionen als Gesellschaftskritik. Wenn es darum geht, die Interessen zu reflektieren, die damit verbunden werden, dass z. B. politische oder juristische Entscheidungen mit Hilfe von Institutionen durchgesetzt werden, wird die Kritik zur Ideologiekritik. Weil zu solchen Institutionen nicht nur globale Medienkonzerne oder Nationalstaaten, sondern auch medienpädagogische Einrichtungen gehören, ist es vonnöten im Rahmen der medienpädagogischen Begriffsarbeit die Medien*Kritik als Ideologiekritik auch im Blick auf das medienpädagogische Denken und Handeln zu thematisieren, um sie zur Grundlage einer Aufgeklärten Medienpädagogik (vgl. Redeker et al. 2024) machen zu können. Dabei steht seit Karl Mannheim (1929/2024) auch eine Unterscheidung verschiedener politischer Ideologien im Raum: Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus, Anarchismus etc. …
Entscheidend ist dabei, dass seit dem 17. und 18. Jahrhundert verschiedene Formen der Ideologiekritik entstanden sind, denen dieses Schwerpunktheft der MEDIENIMPULSE gewidmet wird. So wurden bereits die Kinder der Aufklärung und Erben der Enzyklopädisten von Antoine Louis Claude Destutt de Tracy im Französischen als Ideologen (fr. les idéologues) bezeichnet, wobei sich die Aufklärer:innen – etwa im Sinne der Religionskritik – der Sache nach selbst als Ideologiekritiker:innen begriffen haben. Insofern stellen auch die drei Kritiken Immanuel Kants – Kritik der reinen Vernunft (1781), Kritik der praktischen Vernunft (1788) und Kritik der Urteilskraft (1790) – einen entscheidenden Herkunftsort des modernen Kritikbegriffs dar. Marx und Engels haben dann im Umfeld des sog. Links- oder Junghegelianismus mit Die deutsche Ideologie (1845–1846) einen maßgeblichen Gründungsakt der Ideologiekritik vollzogen, der sich schlussendlich auch der von den beiden konstatierten „nagenden Kritik der Mäuse“ entziehen konnte, weil dieser Text dann doch mehr als einflussreich geworden ist.
Denn nicht zuletzt im Rahmen der Frankfurter Schule – von Walter Benjamins Zur Kritik der Gewalt (1920/1921) bis hin zu Jürgen Habermas – und der Kritischen Theorie wurde im Rekurs auf Kant, Marx und Engels am Begriff der Ideologie weitergearbeitet, wodurch u. a. auch Technik und Wissenschaft als Ideologie (Habermas 1968) analysiert werden konnten. Dies steht in einem intrinsischen Zusammenhang mit den Grundanliegen einer Medienpädagogik, die sich als Gesellschafts-, Handlungs- und eben Ideologiekritik begreift und so zur Grundlage der Handlungsorientierung in der professionellen Arbeit gemacht werden kann. Insofern stellt sich auch heute noch angesichts der „Materialität der Kommunikation“ (Gumbrecht/Pfeiffer 1995) die Frage nach dem genauen Verhältnis von Produktionsbedingungen und Ideen bzw. (politischen) Ideologien und ihrer möglichen bzw. notwendigen Kritik sowie die Herausforderung, die Antworten in professionellen Methoden und Werkzeugen zum Ausdruck zu bringen. Dies hat auch Terry Eagleton (2000) deutlich gemacht, indem er die verschiedenen Rollen und Funktionen des Ideologiebegriffs zur Diskussion stellte.
Mit dem Call zur Ausgabe 02/2025 der MEDIENIMPULSE „Ideologiekritik und Medienpädagogik“ laden wir ein, diese und weitere Probleme und Herausforderungen im Verhältnis von Medienpädagogik und aktuellen Entwicklungen ideologiekritisch zu diskutieren. Relevant können dafür unter anderem die folgenden Fragen sein.
- Welche Eigentumsbegriffe ermöglichen Menschen einen souveränen und humanen Umgang mit den Ideologien, die in Geräten und Inhalten zum Ausdruck gebracht werden?
- Wie können Menschen sich und ihre Medien mit und gegenüber Ideologien frei gestalten?
- Wie kann die Öffentlichkeit als Repräsentation einer vielfältigen Ideologienlandschaft gestaltet werden?
- Welche Rollen und Funktionen übernehmen dabei politische Ideologien wie Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus oder Anarchismus?
- Inwiefern erfordert die digitale Öffentlichkeit neue Formen der Vermittlung zwischen Ideologien bzw. ideologischen Positionen und pluralistischer Toleranz?
- Wie kann eine so gefasste Heterogenität der Ideologien im Medienbildungsbegriff im Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen bedacht werden?
- Welche medienpädagogischen Inhalte können als Medienkompetenz und Medien*Kritik im Blick auf den Umgang mit Ideologien ausgewiesen werden?
- Welche medienpädagogischen Methoden sind geeignet, um Menschen zu einem eigenständigen Umgang mit Ideologien anzuregen?
- Wie können Materialien zur Thematisierung von Ideologien gestaltet werden – und welche gibt es bereits?
Die Redaktion freut sich auf Beiträge, in denen diese und andere, durch die ideologische Verblendung der Redaktion hier nicht inkludierte Fragen, aufgegriffen und im Blick auf medienpädagogisches Denken und Handeln diskutiert werden.
Einreichung der Artikel
Bitte reichen Sie Ihre Beiträge auf unserer Homepage über das Redaktionssystem unter folgendem Link ein:
https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/about/submissions
Umfang der Beiträge im Bereich Schwerpunkt: 20.000–45.000 Zeichen. Falls Ihr Beitrag ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen soll, reichen Sie ihn bitte bis zum 15. Mai 2025 ein. Beiträge ohne Peer-Review-Verfahren können bis zum 21. Mai 2025 eingereicht werden. Erscheinungstermin dieser Ausgabe ist der 21. Juni 2025.
Neben der thematischen Schwerpunktsetzung können Beiträge für alle Ressorts der MEDIENIMPULSE eingereicht werden. Beiträge, die ein Peer Review-Verfahren durchlaufen haben, werden durch einen eigenen Vermerk kenntlich gemacht.
Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen und stehen selbstverständlich gerne für eventuelle Rückfragen zur Verfügung!
• Redaktionsschluss: 15. Mai 2025
• Erscheinungsdatum: 21. Juni 2025
Die Herausgeber:innen dieser Schwerpunktausgabe sind
Alessandro Barberi
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg / Universität Wien
(alessandro.barberi@ovgu.magdeburg)
(alessandro.barberi@univie.ac.at)
(alessandro.barberi@medienimpulse.at)
Christian Swertz
Universität Wien
(christian.swertz@univie.ac.at)
Literatur
Baacke, Dieter (1974): Kritische Medientheorien, München: Juventa.
Eagleton, Terry (2000): Ideologie, Eine Einführung, Heidelberg/Berlin: Metzler.
Engels, Friedrich/Marx, Karl (1969): Die deutsche Ideologie, in: MEW Band 3, 5–530.
Gumbrecht, Hans-Ulrich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hg.) (1995): Materialität der Kommunikation, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1968): Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kant, Immanuel (1998a): Kritik der reinen Vernunft 1 & 2, in: Weischedel, Wilhelm (Hg.): Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, Band III & IV, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Mannheim, Karl (2024): Ideologie und Utopie. Neuausgabe der Originalfassung von 1929, Wiesbaden: Springer VS.
Marx, Karl (1974): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie: (Rohentwurf); 1857–1858; Anhang 1850–1859, Berlin: Dietz.
Marx, Karl (1989): Das Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band, Berlin: Dietz.
Redeker, Anke/Swertz, Christian/Barberi, Alessandro (2024): Aufgeklärte Medienpädagogik, MEDIENIMPULSE 62/2, online unter: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/issue/view/666 (letzter Zugriff: 15.02.2025).
Wilde, Katrin/Kittelmann, Verena/Iske, Stefan/Barberi Alessandro (2025) Editorial: Medien*Kritik. Zur Normativität im Diskurs der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. 14. Magdeburger Theorieforum 2023», in: MedienPädagogik 64i–ix. https://doi.org/10.21240/mpaed/64/2025.01.10.X
_____________________________________________________________________
English Version
MEDIENIMPULSE Call 02/2025
Critique of ideology and media education
Alessandro Barberi
Christian Swertz
Since the founding days of media education, the reflexive concept of critique - not least as media*critique - has been embedded in the terms, discourses and institutions of the discipline (cf. Wilde et al. 2025). For example, Immanuel Kant's Critique of Pure Reason or Karl Marx's Critique of Political Economy were already clearly received in the 1970s as part of critical media theories (Baacke 1974). In everyday life, too, many people speak of self-criticism, criticism of capitalism, criticism of behaviour, social criticism, language criticism or criticism of the times, or describe something as "beneath criticism".
Criticism - systematically organised - thus refers to three things: The reflection of one's own thinking as cognitive criticism, the reflection of the thinking of others as intersubjective criticism and the reflection of institutions as social criticism. When it comes to reflecting on the interests associated with the fact that, for example, political or legal decisions are enforced with the help of institutions, criticism becomes ideological criticism. Because such institutions include not only global media corporations or nation states, but also media education institutions, it is necessary to thematise media*criticism as ideology criticism in the context of media education conceptual work, also with regard to media education thinking and action, in order to be able to make it the basis of enlightened media education (cf. Redeker et al. 2024). Since Karl Mannheim (1929/2024), a distinction has also been made between different political ideologies: liberalism, conservatism, socialism, anarchism, etc. ...
The decisive factor here is that various forms of ideological criticism have emerged since the 17th and 18th centuries, to which this special issue of MEDIENIMPULSE is dedicated. The children of the Enlightenment and heirs of Antoine Louis Claude Destutt de Tracy's encyclopaedists were already referred to as ideologues (fr. les idéologues) in French, whereby the Enlightenment thinkers - in the sense of religious criticism, for example - saw themselves as ideological critics. In this respect, Immanuel Kant's three critiques - Critique of Pure Reason (1781), Critique of Practical Reason (1788) and Critique of Judgement (1790) - represent a decisive point of origin for the modern concept of critique. Marx and Engels then carried out a decisive founding act of ideological criticism in the environment of so-called left-wing or Young Hegelianism with The German Ideology (1845-1846), which was ultimately able to elude the "gnawing criticism of mice" that the two stated, because this text then became more than influential.
Not least within the framework of the Frankfurt School - from Walter Benjamin's On the Critique of Violence (1920/1921) to Jürgen Habermas - and Critical Theory, the concept of ideology was further developed with recourse to Kant, Marx and Engels, whereby, among other things, technology and science could also be analysed as ideology (Habermas 1968). This is intrinsically linked to the basic concerns of media education, which sees itself as a critique of society, action and ideology and can thus be used as the basis for action orientation in professional work. In this respect, in view of the "materiality of communication" (Gumbrecht/Pfeiffer 1995), the question of the exact relationship between production conditions and ideas or (political) ideologies and their possible or necessary criticism still arises today, as does the challenge of expressing the answers in professional methods and tools. Terry Eagleton (2000) also made this clear by discussing the various roles and functions of the concept of ideology.
With the call for the 02/2025 issue of MEDIENIMPULSE "Ideology Criticism and Media Education", we invite you to discuss these and other problems and challenges in the relationship between media education and current developments from an ideology-critical perspective. The following questions, among others, may be relevant.
- Which concepts of ownership enable people to deal confidently and humanely with the ideologies expressed in devices and content?
- How can people freely organise themselves and their media with and in relation to ideologies?
- How can the public sphere be organised as a representation of a diverse ideological landscape?
- What roles and functions do political ideologies such as liberalism, conservatism, socialism or anarchism take on?
- To what extent does the digital public sphere require new forms of mediation between ideologies or ideological positions and pluralistic tolerance?
- How can such a heterogeneity of ideologies be considered in the concept of media education with regard to people's personal development?
- What media education content can be recognised as media literacy and media*criticism with regard to dealing with ideologies?
- Which media education methods are suitable for encouraging people to deal with ideologies independently?
How can materials for thematising ideologies be designed - and which ones already exist?
The editorial team is looking forward to contributions in which these and other questions, which are not included here due to the ideological blindness of the editorial team, are taken up and discussed with regard to media educational thinking and action.
Submission of articles
Please submit your articles to our homepage via the editorial system using the following link:
https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/about/submissions
Length of articles in the focus section: 20,000-45,000 characters. If your contribution is to undergo a peer review process, please submit it by 15 May 2025. Contributions without peer review can be submitted until 21 May 2025. The publication date of this issue is 21 June 2025.
In addition to the thematic focus, contributions can be submitted for all sections of MEDIENIMPULSE. Contributions that have undergone a peer review process will be identified by a separate note.
We look forward to receiving your submissions and will of course be happy to answer any questions you may have!
- Editorial deadline: 15 May 2025
- Publication date: 21 June 2025
The editors of this special issue are
Alessandro Barberi
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg / Universität Wien
(alessandro.barberi@ovgu.magdeburg)
(alessandro.barberi@univie.ac.at)
(alessandro.barberi@medienimpulse.at)
Christian Swertz
Universität Wien
(christian.swertz@univie.ac.at)
Literature
Baacke, Dieter (1974): Kritische Medientheorien, München: Juventa.
Eagleton, Terry (2000): Ideologie, Eine Einführung, Heidelberg/Berlin: Metzler.
Engels, Friedrich/Marx, Karl (1969): Die deutsche Ideologie, in: MEW Band 3, 5–530.
Gumbrecht, Hans-Ulrich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hg.) (1995): Materialität der Kommunikation, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1968): Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kant, Immanuel (1998a): Kritik der reinen Vernunft 1 & 2, in: Weischedel, Wilhelm (Hg.): Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, Band III & IV, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Mannheim, Karl (2024): Ideologie und Utopie. Neuausgabe der Originalfassung von 1929, Wiesbaden: Springer VS.
Marx, Karl (1974): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie: (Rohentwurf); 1857–1858; Anhang 1850–1859, Berlin: Dietz.
Marx, Karl (1989): Das Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band, Berlin: Dietz.
Redeker, Anke/Swertz, Christian/Barberi, Alessandro (2024): Aufgeklärte Medienpädagogik, MEDIENIMPULSE 62/2, online unter: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/issue/view/666 (letzter Zugriff: 15.02.2025).
Wilde, Katrin/Kittelmann, Verena/Iske, Stefan/Barberi Alessandro (2025) Editorial: Medien*Kritik. Zur Normativität im Diskurs der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. 14. Magdeburger Theorieforum 2023», in: MedienPädagogik 64i–ix. https://doi.org/10.21240/mpaed/64/2025.01.10.X