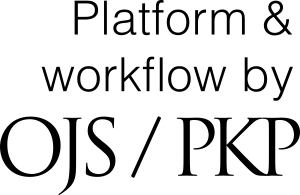Geschlecht, Arbeit und Ungleichheit in der OeZG
Jessica Richter & Tim Rütten
Wo eine*r hinschaut, Geschlechterungleichheit durchzieht alle Bereiche der Gesellschaften (nicht nur) in Europa. Frauen sind politisch schlechter vertreten, stoßen bei der Verteilung von Posten und Positionen an betonierte Decken, sind häufiger von Armut betroffen. Im Schnitt arbeiten sie länger als Männer und erhalten weniger Gehalt – sogar dann, wenn sie derselben Erwerbstätigkeit wie ihre männlichen Kollegen nachgehen. Am Ungleichgewicht in der Verteilung von Care-Arbeit hat sich trotz der jahrzehntelangen feministischen Kritik erschreckend wenig getan.
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Um zu verstehen, wie sich Ungleichheit zwischen Frauen und Männern historisch durchgesetzt und immer wieder neu hergestellt hat, lohnt die Untersuchung von Arbeit(sverhältnissen). In der kapitalistischen Moderne fungiert(e) Arbeit als „Platzanweiserin“: Sie avancierte zum Lebenszweck per se und positionierte Menschen in der Gesellschaft. Die Hierarchisierung von Berufen und Lebensunterhalten entlang von Geschlecht, sozialer und soziogeographischer Herkunft etc. bestimmte auch die Rangordnung zwischen Menschen mit. Mit den Vorstellungen der Liebesheirat, privater Idylle und den Imaginationen ‚natürlicher‘ geschlechtsspezifischer Eigenschaften und Fähigkeiten setzte sich ferner das Ideal der für das häusliche Wohl zuständigen Frauen zunehmend durch. Während häusliche Tätigkeiten als unproduktiv und immer weniger als Arbeit verstanden wurden, sollten Männer miteinander um Berufe, Posten und Prestige in Konkurrenz treten. Sie allein galten als produktiv, als Träger von Kompetenz und Wissen.
Feministische Forschung hat vielfach darauf hingewiesen, dass solche Bewertungen Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse waren und sind. Wenn Feministinnen etwa für einen weiten Arbeitsbegriff stritten (und damit die systematische Exklusion der Tätigkeiten von Frauen aus der Arbeit anprangerten), schlossen sie an historisch ältere Bewertungen an. In der Frühen Neuzeit und auch davor war es den meisten Menschen einsichtig, dass häusliche Tätigkeiten Arbeit waren, spezifische Fähigkeiten verlangten und durch die produzierende Komponente z.B. bei der Zubereitung und Konservierung von Nahrungsmitteln ebenso wie andere Tätigkeiten und Erwerbe überlebensnotwendig waren. Den häuslichen Dienst als Magd oder Knecht betrachteten sie unter ähnlichen Vorzeichen. Er galt selbstredend als Arbeit, auch wenn diese ständisch verankert und unfrei war. Der auf Lohnarbeit verengte Arbeitsbegriff hingegen ist historisch relativ neu, ein Produkt des 18. und 19. Jahrhunderts.
Der Band "Arbeit und Geschlecht" (3/2022) nimmt sich jene Prozesse der Hierarchisierung zum Gegenstand. Er versucht in Einzelstudien zu ergründen, welche Mechanismen, Diskurse und Praktiken seit dem 16. Jahrhundert zu den Hierarchien zwischen ‚weiblich‘ und ‚männlich‘ konnotierter Arbeit, zwischen Frauen und Männern beigetragen haben.
In der OeZG hat die Auseinandersetzung mit Arbeit und Geschlechterungleichheit bereits Tradition. Helmut Bräuer setzte sich 1990 mit den Schwierigkeiten auseinander, den Beitrag von Frauen und Kindern zur handwerklichen Produktion und Haushaltsorganisation anhand der verfügbaren Quellen zu bemessen (2/1990). Im Mittelpunkt standen bei ihm aber die Konflikte von Gesellen mit ihren Meistern um den Wert und das Eigentum an ihrer Arbeit. In 2/2011 analysierte Susanne Hoffmann den Zusammenhang von Männlichkeit, Gesundheit und Arbeit anhand von unveröffentlichten autobiografischen Quellen. Ihre alltagsdiskursive Untersuchung arbeitet geschlechtsspezifische Einstellungen zu Gefahr und Arbeit heraus und zeigt, dass Werktätige ihre eigene Arbeit entlang von gegenderten Auffassungen einordneten und bewerteten. Aus umgekehrter Perspektive erforschte Andreas Weigel in derselben Ausgabe den Konnex Weiblichkeit, Gesundheit und Arbeit im 20. Jahrhundert.
Der 2013 von Alexander Mejstrik, Sigrid Wadauer und Thomas Buchner herausgegebene Band „Die Erzeugung des Berufs“ (1/2013) befasst sich mit den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in deren Rahmen Berufe als legitimste Möglichkeit des Lebensunterhalts durchgesetzt wurden. Mareike Witkowski untersucht in ihrem Beitrag, wie der häusliche Dienst einerseits als schmutzig und unterprivilegiert und andererseits als ideale Vorbereitung auf ein späteres Leben für Frauen entworfen wurde.
In 1+2/2014 fragten sich Nora Bischoff, Flavia Guerrini und Christine Jost am Beispiel des Landeserziehungsheims St. Martin in Schwaz in Tirol, wie Erziehung(-spraktiken), Geschlechtervorstellungen sowie Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse zur Mitte des 20. Jahrhunderts zusammenhingen. Die Autorinnen können nachweisen, dass es anders als vom Gesetz vorgesehen hier nicht um eine höherwertige Berufsqualifizierung für Frauen ging, sondern vor allem um eine Gewöhnung an Arbeit in als ‚weiblich‘ verstandenen Berufen wie jenem der Wäscherin. Im gleichen Band geht Martin Scheutz der Verbindung von Arbeit, Erziehung und Religion am Beispiel frühneuzeitlicher Waisenhäuser nach. Die zur Zeit Maria Theresias noch übliche Trennung nach Geschlecht wurde später aufgehoben, wobei der Anteil an Buben überwog. Bereiteten die Waisenhäuser Mädchen auf den Beruf der Dienstbotin vor, sollten Jungen für ein Handwerk ausgebildet werden. Wie andere Autor*innen der OeZG adressiert Scheutz auch Fragen nach der sozialen Schichtung und hat damit die Suche nach den Verbindungen und Überkreuzungen zwischen gesellschaftlichen Struktur- und Ungleichheitskategorien mit anderen Autor*innen gemein.
Wie der aktuelle Band „Arbeit und Geschlecht“ vor Augen führt, hat sich das Potenzial von Forschungen, die zu einem besseren Verständnis der Verwobenheit von Arbeit und Geschlechterverhältnissen in historischen Gesellschaften beitragen möchten, noch lange nicht erschöpft. Diese gilt es insbesondere in einer Zeit zu verteidigen, in der die Institutionalisierung der Gender Studies an den Universitäten immer wieder in Frage gestellt wird.