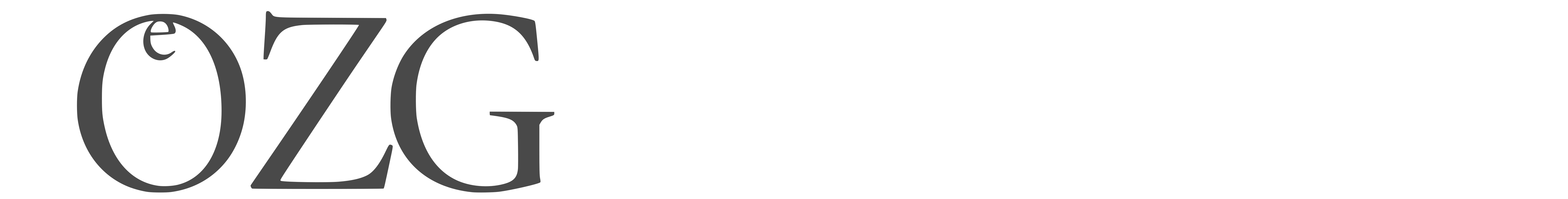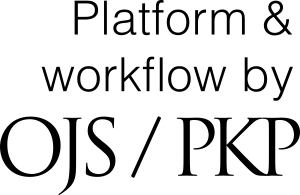Frauenbewegungen und Wissensformationen / Women’s Movements and Knowledge Formations
Johanna Gehmacher und Dietlind Hüchtker
Natalja Kobryns’ka, eine um 1900 im habsburgischen Galizien aktive ukrainische Feministin, sammelte Wissen über Frauenwahlrecht, darüber, wo in Europa welche Frauen und welche Organisationen welche Formen von Wahlrecht forderten, wie, wann und wie viele dies taten.[1] In einem Artikel über „Die Bestrebungen der Frauenbewegung“, der 1895 und 1896 in dem von ihr selbst herausgegebenen und an die ukrainischen Frauen Galiziens gerichteten dreibändigen Almanach „Unser Schicksal“ erschienen war, listete sie ihr Wissen genau auf. Wozu, fragt man sich, warum sollten ukrainische Frauen über Detailfragen aus Dänemark oder Frankreich informiert werden? Kobryns’ka demonstrierte ihre politischen Kenntnisse, sie stellte aber auch ihre Verbundenheit mit den verschiedenen Frauenbewegungen und -initiativen der Zeit heraus – und sie wusste ganz offenbar über die Zusammenhänge von Wissen, Politik und Macht Bescheid. Diesen Zusammenhängen widmet sich der Band „Frauenbewegungen und Wissensformationen / Women’s Movements and Knowledge Formations“ (OeZG 2/2025) in einer epochenübergreifenden Weise und knüpft damit an Überlegungen zu Praktiken und Strategien von Frauenbewegungen an, wie sie bereits in OeZG-Bänden zur Transformation von Frauenpolitik (OeZG 2/2015) und zu Konzepten von Radikalität in Frauenbewegungen (OeZG 1/2024) aufgeworfen wurden.
Lesen Sie mehr über Frauenbewegungen und Wissensformationen / Women’s Movements and Knowledge Formations