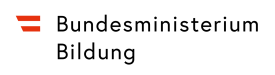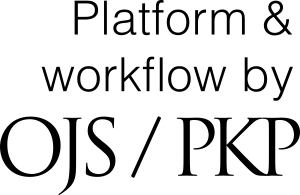Der Homo Ludens in der digitalen Medienbildung
Ästhetik, Bildung und Digitalisierung
DOI:
https://doi.org/10.21243/mi-02-24-22Abstract
Ausgangspunkt ist Johan Huizingas Konzept des Spiels als Grundelement kultureller Praxis. Huizinga beschreibt das Spiel als eine freiwillige Tätigkeit, die Regeln folgt und außerhalb des normalen Lebens stattfindet. Es löst Spannungen und fördert kreative Ausdrucksformen. Die darauf aufbauenden Ausführungen betonen die Bedeutung des Homo Ludens in der digitalen Medienbildung. Das Ludische kann helfen, Bildungsprozesse zu entkontextualisieren und kreatives Potenzial freizusetzen. Der spielerische Umgang mit digitalen Medien hinterfragt die Grenzen vorgegebener Strukturen und fördert neue Denkweisen. Ein spielerischer Zugang zur Ästhetik ermöglicht individuelle und unvorhersehbare Begegnungen mit Kunst, frei von vorgegebenen Zielen und Kompetenzen. Bildungssettings mit digitalen Medien sollten als offene Räume gestaltet werden, die solche Erfahrungen ermöglichen.
Literaturhinweise
Adorno, Theodor W. (1962): Theorie der Halbbildung, in: Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (Hg.): Sociologica II, Reden und Vorträge (= Frankfurter Beiträge zur Soziologie 10), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 160–180.
Brandstätter, Ursula (2008): Grundfragen der Ästhetik. Bild – Musik – Sprache – Körper, Köln u. a.: Böhlau.
Eco Umberto (1962): Das offene Kunstwerk, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hug, Theo (2022): Digitaler Klimawandel. Reflexionsanregungen und Impulse für den Unterricht. Vorbemerkungen und didaktische Überlegungen, in: MEDIENIMPULSE, Jg. 60, Nr. 3, online unter: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/7461 (letzter Zugriff: 15.06.2024).
Huizinga, Johan (2009): Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 21. Auflage, Reinbek: Rowohlt.
Humboldt, Wilhelm von (1964): Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, in: Ballauff, Theodor/Groothoff, Hans-Hermann/Mühlmeyer, Heinz/Üpllen, Karl (Hg.): Wilhelm von Humboldt. Bildung des Menschen in Schule und Universität, Heidelberg: Quelle & Meyer, 30–40.
Humboldt, Wilhelm von (1966): Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen [1792], in: Flitner, Andreas/Giel, Klaus (Hg.): Humboldt-Werke, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Lovink, Geert (2022): In der Plattformfalle. Plädoyer zur Rückeroberung des Internets, Bielefeld: transcript, online unter: https://tinyurl.com/bdm45f4t (letzter Zugriff: 15.06.2024).
Rancière, Jacques (2008): Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, 2. durchgesehene Auflage, Berlin: b_books.
Rancière, Jacques (2012): Eine andere Art von Universalität, in: Bandi, Nina/Kraft, Michael G./Lasinger, Sebastian (Hg.): Kunst, Subversion, Krise. Zur Politik der Ästhetik, Bielefeld: transcript, 183–194.
Rancière, Jacques (2013): Aisthesis. Vierzehn Szenen, Wien: Passagen.
Rosenkranz, Karl (2007): Ästhetik des Häßlichen, Ditzingen: Reclam.
Schiller, Friedrich (2009): Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, Kommentar von Stefan Matuschek, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Swertz, Christian/Berger, Christian/Messner, Sonja/Holubek, Renate/Pöyskö, Anu/Pollek, Margit (2022): Stellungnahme des Bundesverbands Medienbildung (BVMB) zum Entwurf des Lehrplans für Digitale Grundbildung vom 02.05.2022, in: MEDIENIMPULSE, Jg. 60, Nr. 3, 1–4, online unter: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/7555/ (letzter Zugriff: 15.06.2024).
Wing, Jeanette (2003): Computational Thinking, in: Communications of the ACM, Jg. 49, Nr. 3, 33–35, online unter: https://cacm.acm.org/opinion/computational-thinking/ (letzter Zugriff: 15.06.2024).
Downloads
Veröffentlicht
Zitationsvorschlag
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2024 Andreas Hudelist

Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 International -Lizenz.